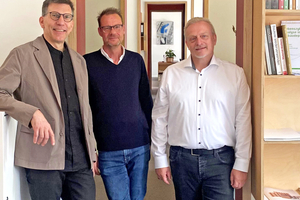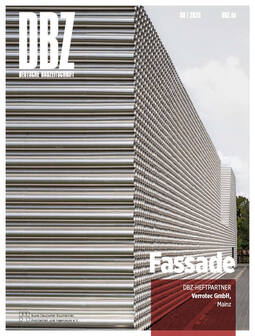KI-Tools für die Gebäudehülle
Michael Schuster: Welche Perspektiven öffnet der Einsatz von KI-Tools in der Fassadenplanung?
Jan R. Krause: Wir sind heute zu Gast im Architekturbüro Störmer Murphy and Partners in Hamburg, und ich finde die Sortierung ganz interessant, die uns Hanns-Jochen Weyland, Associate Partner und verantwortlich für Digitale Transformation, präsentiert hat: Es gibt entwurfsunterstützende Tools wie Veras oder confy ui. Es gibt Tools, die helfen können, Grundrissalternativen zu erstellen wie Finch, oder Fassaden konstruktiv und energetisch zu optimieren. Und es gibt ein ganzes Instrumentarium an Tools, das wir für Informationsmanagement und Administration gebrauchen können, wie ChatGPT oder n8n für Workflow Automation. Diese Einordnung von KI-Tools in Architekturbüros funktioniert nicht nur für die Fassadenplanung oder für die Gebäudehülle, sondern ganz grundsätzlich für Planungsprozesse. Zum großen Feld der Optimierungstools würde ich auch KI-Tools zählen, die Auswirkungen auf den Gebäudebetrieb und auf die Lebenszykluskosten ausweisen, wie zum Beispiel keeValue.
Michael Schuster: Wie verändert der Einsatz von KI-Tools die Planungsprozesse gegenüber traditionellen Planungsmethoden?
Jan R. Krause: Wenn wir die Tools gut zu nutzen verstehen, werden sich Planungsprozesse in bestimmten Phasen beschleunigen und präzisieren lassen. Wir haben die Möglichkeit, eine größere Variantenvielfalt zu erzeugen, zu entwerfen oder auch zu verwerfen. Wir erhalten in frühen Phasen eine größere Annäherung an eine entwurfsbegleitende Bewertung, zum Beispiel hinsichtlich der Umweltauswirkungen und der Kosten.
Michael Schuster: Hanns-Jochen Weyland meinte, wir können KI-gestützt viele tausend verschiedene Fassadentypen entwickeln, aber am Ende muss doch jemand begründen und entscheiden, welche der Varianten weiterverfolgt werden soll. Bleibt dies weiterhin die Kernkompetenz von Architekten und Ingenieuren?
Jan R. Krause: Die Variantenvielfalt hat eine gewisse Faszination, aber andererseits widerspricht diese Beliebigkeit unserer Art, als Architekten zu denken und zu entwerfen, weil wir ja in der Regel im Dialog mit dem Auftraggeber Entwurfsziele formulieren. Ausgerichtet auf diese Ziele entwickeln wir Konzepte und Kriterien. Diese stehen dann leitmotivisch für den weiteren Entwurfs- und Detaillierungsprozess. Das sind zentrale Schritte, die zuerst erfolgen müssen, auch in KI-gestützten Prozessen, um die Variantenerzeugung besser steuern und schließlich besser beurteilen zu können. Natürlich kann es auch passieren, dass die KI halluziniert und überraschende Ansätze liefert, an die man gar nicht gedacht hätte und dann doch mit in die engere Wahl nimmt, um sie zu überprüfen. Diese KI-Zufallsmethode kann eine interessante Bewusstseinserweiterung sein. Aber auch dafür muss man ein Sensorium entwickeln, welches die interessanten Fehler sind, die von der KI produziert werden und ganz neue Aspekte eröffnen.
Michael Schuster: In welchen Phasen der Fassadenplanung lassen sich KI-Tools konkret einsetzen?
Jan R. Krause: Die Fassade ist das aufmerksamkeitsstärkste und öffentlichste Element eines Hauses, das die größten Emotionen weckt. Hier gibt es viel Gesprächsbedarf in einer frühen Phase, weil es darum geht, Identität zu gestalten und Stadträume zu prägen. Deswegen glaube ich, dass KI-Tools schon in der Leistungsphase Null, in einem Partizipationsverfahren, eine große Bedeutung haben können, um sehr früh unterschiedliche Optionen mit geringem Aufwand vorstellen zu können. Es besteht die Chance, früh unterschiedliche Optionen vergleichbar zu machen und mit einer größeren Gemeinschaft zu besprechen, um verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen und sichtbar zu machen, welche Aspekte an einem bestimmten Ort für eine spezifische Aufgabe atmosphärisch leiten können. Wichtig ist aber, zu erklären, dass es in dieser Phase der Partizipation nicht um einen konkreten Fassadenentwurf geht, sondern darum, welche Anmutung oder welche Fassung eines Stadtraums wir hier suchen. Die scheinbare Perfektion KI-generierter Bilder birgt immer die Gefahr, dass sie mit der Realität verwechselt werden. Die Komplexität von Architektur und Fassaden bleibt erklärungsbedürftig und erfordert ein hohes Maß an Kommunikationsmanagement.
Michael Schuster: Jetzt haben wir einen durch oder mit KI generierten Entwurf, aber wie bekomme ich den in eine Planungssoftware wie CAD oder BIM transportiert?
Jan R. Krause: Wenn es in die konkrete Planung geht, dann verschmelzen tradierte Entwurfsmethoden mit den neuen technologischen Möglichkeiten. Ich denke, dass in der Regel für viele Architekturbüros weiterhin das städtebauliche Massenmodell die erste Annährung an einen Ort ist, in dem man Kubatur, Ausrichtung und Zonierung überprüfen kann und entwickelt. Mit einer Skizze oder einem Massenmodell kann man KI-gestützt schnell zu einer Visualisierung kommen. Der AI Visualizer von Graphisoft oder KI-Tools wie Archivinci können Fassaden wie einen Vorhang über eine frühe Skizze oder über ein digitales Massenmodell legen, ohne dass man dafür schon eine präzise CAD-Modellierung braucht. Aber es ist weiterhin wichtig zu unterscheiden, dass dies nicht der Entwurf, sondern nur eine Annäherung an den Entwurf sein kann, die zum Beispiel Hinweise auf Materialitäten, Proportionen und Atmosphären liefert, ähnlich wie ein Moodboard, mit dem wir schnell komponieren und aussortieren können. Das kann ein wichtiges Kommunikationstool sein. Dann aber müssen diese Fassadenstudien ins „Algorithmus-Fitness Center“, wie es Uli Blum, der Head of AI bei Zaha Hadid nennt.
Michael Schuster: Und dort werden sie dann hinsichtlich Funktion und Nutzen optimiert. Welche konkreten Aufgaben übernehmen denn KI-Systeme bei den Projekten?
Jan R. Krause: Künstliche Intelligenz wird dann besonders interessant, wenn sie die Komplexität unterstützen kann, die in der Architektur steckt. Die Gebäudehülle ist ja nicht nur ein Bild in der Stadt, sondern hat vielfältige Funktionen für das Haus zu erfüllen. Es geht immerhin um rund zehn bis zwanzig Prozent des CO₂-Footprints eines Gebäudes. Insofern ist es gut, wenn wir KI-gestützt frühzeitig Informationen kriegen, wie sich Entwurfsentscheidungen auswirken. Die Software on click LCA integriert zunehmend KI-Funktionen, um die Datenerfassung und -analyse zu beschleunigen und vereinfachen. Das bereits erwähnte KI-Tool keeValue kombiniert entwurfsbegleitend Auswertungen der Ökobilanz mit Aussagen zu Kostenauswirkungen. Diese Kombination wesentlicher Faktoren wird ein entscheidender Vorteil bei der weiteren Entwicklung von KI-Tools sein: weg von spezialisierten Insellösungen, hin zu integrierten Kombi-Tools, die die Wechselwirkungen von Entwurfsentscheidungen in Echtzeit aufzeigen können. Dazu gehört auch die Potenzialermittlung von Grundstücksausnutzung in Kombination mit der Ertragsermittlung von Photovoltaik in Dach und Fassade, wie es zum Beispiel mit der KI von Syte möglich ist. Es geht aber nicht nur um ökonomische und ökologische Daten, sondern vor allem um die Aufenthalts- und Lebensqualität hinter den Fassaden, um Belichtung, Temperierung und Verschattung. Interessant scheint mir hierfür die in den USA entwickelte Simulationssoftware IESVE. Ein großes Potenzial für KI-Anwendungen besteht darin, Werte, die bisher mit Spezialprogrammen einzeln ermittelt wurden, jetzt zu einem größeren Ganzen zusammenzuführen.
Michael Schuster: Wie verändert KI die Zusammenarbeit der Planungsbeteiligten, also von Architekten, Ingenieuren und Bauherrn?
Jan R. Krause: Ich bin überzeugt, dass KI die Kommunikation im Entwurfsprozess erleichtern wird. Wo heute im Dialog von Auftraggebern und Nutzern, Architekten und Fachplanern mitunter noch spekuliert wird und Wunschdenken auf Erfahrungswissen trifft, da können wir künftig sehr viel schneller die Komplexität von Architektur überprüfen und mit messbaren Werten und belegbaren Qualitäten hinterlegen.
Michael Schuster: Glaubst Du, dass der Einsatz von KI die Entwurfsqualität beeinflusst? Entsteht mit KI eine neue Fassaden-ästhetik?
Jan R. Krause: Ich glaube, dass das Entwerfen weiterhin eine Kernkompetenz von Architektinnen und Architekten bleibt. Wir sind Experten für Räume und Spezialisten für Stadträume. Architekten haben eine spezielle Wahrnehmungsschulung durchlaufen, sie haben die größere Seherfahrung, die größere Bildbibliothek im Kopf, die kulturelle Bildung und sind als echte Experten für Raumwirkung und Komplexität gefragt, damit das Ganze mehr wird als die Summe seiner Teile. Ich glaube nicht, dass KI allein die architektonische Ästhetik verändert oder revolutioniert. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir zu einem neuen architektonischen Ausdruck kommen, wenn wir den Digitalisierungsprozess konsequent zu Ende denken: bis hin zu Digital Craftsmanship und 3D gedruckten Bauteilen oder komplett 3D gedruckten Häusern. Ein Beispiel hierfür sind die von Bjarne Ingels für ICON entworfenen Häuser in Georgetown, Texas. Aufgrund der Führung des 3D-Betondruckers sind die Häuser nicht mehr scharfkantig, sondern haben gerundete Ecken. Wand und Dach sind aus einem Material, einem neuartigen CO₂-reduzierten Beton – im wahrsten Sinne des Wortes aus einem Guss. Mit dieser Technologie gehen neue Formfindungsprozesse einher, neue Oberflächen, Texturen, Details. Das ist dann nicht allein eine Frage von KI, sondern von digitaler Transformation in Entwurf und Produktion.
Michael Schuster: Gibt es beim Einsatz von KI eigentlich Einschränkungen bei der kreativen Kontrolle?
Jan R. Krause: Die Arbeit mit künstlicher Intelligenz ist ein Ringen um Kontrolle und Kontrollverlust. Wie gut können wir die KI‘s steuern? Wie gut bedient die KI das, wonach wir suchen? Wo agiert die KI eigenmächtig? Kann ich meiner KI vertrauen? Mit vielen KI‘s ist es möglich, eine Glasfassade in eine Holzfassade zu verwandeln. Meist wird das neue Material dann aber auf die gesamte Gebäudehülle appliziert. Noch ist es schwierig, nur Teilbereiche eines KI generierten Bildes anzusteuern und zu verändern, wie etwa mit dem KI-Tool lookx. Wir werden aber weitere Tools an die Hand bekommen, mit denen wir präzise eingreifen können, um nur das Dachgeschoss oder das Erdgeschoss zu bearbeiten. Das ist auch eine Frage professionellen Promptings. Die Ansprache und Bedienung von KI-Tools braucht viel Erfahrung, um gerade in der Planung von Gebäudehüllen wirklich effizient zu sein und über den schnellen Effekt von Anmutungsbildern hinaus zu kommen. Hanns-Jochen Weyland von Störmer Murphy and Partners übersetzt AI mit “Augmented Intelligence” und vergleicht die Anwendung mit dem Erlernen eines Musikinstruments. Ein gutes Klavier zu kaufen bedeute noch nicht, dass man es konzertreif spielen kann.
Michael Schuster: Welche KI-Technologien kommen bei der Fassadenplanung konkret zum Einsatz?
Jan R. Krause: Wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass manche der hier genannten KI‘s eher Plattformen, Softwarelösungen oder spezifische Algorithmen sind, die KI-Technologien nutzen, anstatt eigenständige KI‘s zu sein. Grundsätzlich haben wir zwei Optionen. Das eine sind die in die CAD- und BIM-Modelle integrierten KI-Tools, die ähnlich funktionieren wie ein Co-Pilot, den wir auch aus Textbearbeitung, Zoom-Konferenzen oder anderen Welten kennen. Das sind passgenaue Tools, die die jeweilige CAD-Software gut bedienen wie zum Beispiel Pele AI für Revit. Die andere Kategorie ist die der eigenständigen Tools, die spezifische Prozesse wie Aufmaß oder Nachhaltigkeitsberechnung unterstützen. Hier finde ich Tools wie Revalu oder EC3 von building transparency besonders interessant für die Materialbewertung.
Michael Schuster: Kennst Du Projekte, wo KI-Tools in der Fassadenplanung bereits eingesetzt wurden?
Jan R. Krause: Das Büro GRAFT in Berlin verfolgt eine eigenständige KI-Entwurfsstrategie, um zum Beispiel aus regionaltypischen Landschaftsmotiven oder Farbwelten KI-gestützt Fassadenmotive zu entwickeln. Das erfolgt sehr kontrolliert und zugleich mit einer großen Variantenvielfalt – aber mit einer klaren Zielvorstellung. Hier geht es darum, den „genius loci” als fundamentalen Ausgangspunkt der Architekturerfindung aufzuspüren und KI-gestützt spezifische Entwürfe zu entwickeln, die Tradition und Innovation miteinander verbinden. Das erfolgt u. a. mit Midjourney und mit der selbst trainierten, büroeigenen KI „EDDI”, die an ein Open AI Modell angehängt ist, um spezifische Analyse- und Programmiertools für die eigenen Arbeitsprozesse zu entwickeln. Ähnlich beschreibt es Hanns-Jochen Weyland: Wir brauchen Open AI und Tools, die von der Industrie rudimentär entwickelt sind, um sie dann für die büroeigenen Prozesse weiterzuentwickeln.
Michael Schuster: Werfen wir einen Blick auf Hülle, Nachhaltigkeit und Performance. Wie unterstützt KI die Optimierung von Fassaden hinsichtlich Energie, Effizienz, Klimaschutz?
Jan R. Krause: Hierzu gibt es mehrere interessante Forschungsprojekte. Ein Beispiel ist das Projekt Flectuation vom ITKE/ITFT der Universität Stuttgart. Auf der 83 m² großen kinetischen Fassade reagieren 101 flexible Faserverbundflügel auf Umweltveränderungen. KI-basierte Algorithmen steuern das Öffnen und Schließen je nach Sonnenstand, Temperatur und Prognosen. Sie verbessern dadurch das Innenraumklima und die Energieeffizienz.
Michael Schuster: Das ist ein recht komplexes Projekt. Wie aber verhält es sich mit der Thematik des Einfachen Bauens?
Jan R. Krause: Das ist eine wichtige Frage, zu der wir einen eigenen KI-Dialog führen sollten. Im Moment erleben wir eine Phase, in der geforscht wird, wie wir KI-gestützt maximale Komplexität beherrschbar machen können. Als nächstes wird es sicherlich darum gehen, wie wir das relativ pragmatisch für den Planungsalltag nutzbar machen können. Am Ende geht es in der Architektur ja um Angemessenheit und nicht um Maximierung aller technologischen Möglichkeiten.
Michael Schuster: Unsere Zeitschrift, die DBZ, ist ein Fachmagazin für Architekten und Ingenieure und steht für die integrale Planung. Könnte man sagen, dass der Einsatz von KI als Booster für Integrale Planung wirkt, wenn die vielschichtigen Aspekte der Fassadenplanung jetzt dichter zusammengeführt werden?
Jan R. Krause: Ich bin fest überzeugt, dass die integrale Planung mit dem Einsatz von KI‘s eine neue Bedeutung bekommt. Ich glaube, es ist längst klar, dass wir nicht mehr linear, hintereinandergeschaltet planen können. Auch KI-gestützt bleibt es eine hohe Ingenieurskunst und eine große Managementkompetenz, die Dinge im Sinne einer integralen Planung zusammenzudenken. Ich glaube nicht, dass KI die Fachingenieure oder die Architekten als Generalisten ersetzt, aber es ermöglicht dem Architekten, andere Fragen zu stellen, indem er diese Unterstützung beim Zusammendenken der Dinge heranziehen und die einzelnen Fachdisziplinen besser koordinieren und führen kann.
Michael Schuster: Neben den Potenzialen, die KI-Tools bieten, gibt es aber auch Herausforderungen. Was sind die größten Hürden, um KI im Architektur- und Ingenieurbüro effizient einzusetzen?
Jan R. Krause: Die größte Herausforderung, vor der viele Büros noch stehen, ist die Frage, wie kriegen wir das in unsere Prozesse integriert, oder wie müssen wir Workflows neu definieren, um KI‘s als neue Team-Mitglieder effizient einzusetzen. Das setzt Investitionen in Tools und Ressourcen voraus. In der Regel liefern die bezahlten Tools bessere Ergebnisse als die frei verfügbaren. Das heißt, man muss Arbeitsplätze mit KI-Lizenzen ausstatten. Dafür gilt es herauszufinden, welches die richtigen Tools sind. Hinzu kommt die spezifische Schulung für bestimmte KI-Tools. Wir müssen auch Freiräume für Mitarbeiter eröffnen, um sich die Tools anzueignen, zu experimentieren und KI‘s mit unseren eigenen Daten zu trainieren. Und: Der AI Act der Europäischen Union verpflichtet dazu, dass Anwender von KI‘s in KI-Kompetenz geschult sind. Da geht es um das grundsätzliche Verständnis, aber auch um Sorgfaltspflicht und rechtliche Fragen.
Michael Schuster: Was hältst Du für die wichtigste KI-Kompetenz von Architekten und Ingenieuren?
Jan R. Krause: Die wichtigste Kompetenz ist, als Büro eine Haltung zum kritisch reflektierten Einsatz von KI zu entwickeln und diese Haltung in der Unternehmenskultur so zu implementieren, dass alle Mitarbeiter ein gemeinsames Verständnis haben. Basis für dieses gemeinsame Verständnis ist Neugier und die Bereitschaft, sich und seinen Beruf mit dieser neuen Technologie weiterzuentwickeln.
Michael Schuster: Dazu gehört sicher auch eine gewisse intrinsische Motivation. Dann schließen wir unser heutiges Gespräch mit einem Goethe-Zitat: „Wer nicht neugierig ist, erfährt nichts.”
Termine:
11.-16.11.2025 AEC Tech – NYC Annual conference
DBZ 10|2025: KI-Tools für Marken und Räume
DBZ 11|2025: KI für Innenraum und Transformation
Rückblick
DBZ 07/08|2025: KI-Tools für die Resiliente Stadt
DBZ 06|2025: KI-Tools für Nachhaltiges Bauen
DBZ 05|2025: Künstliche Intelligenz im Engineering
DBZ 04|2025: KI-Einsatz beim Bauen im Bestand
DBZ 03|2025: KI Innovationen
DBZ 01/02|2025: KI International
DBZ 12|2024: KI Einstieg in den Dialog
DBZ 01/02-2025: Der große KI-Überblick mit Glossar