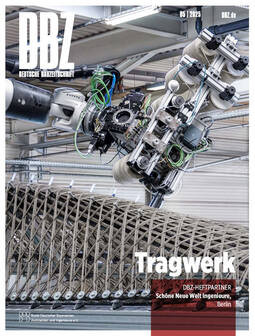Künstliche Intelligenz im Engineering
Michael Schuster: Bisher hatten wir in unserer Reihe „DBZ KI- Dialog” den Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Architektur betrachtet. Heute wollen wir KI-Perspektiven für Ingenieure und Ingenieurinnen beleuchten. Welche Unterschiede lassen sich da feststellen?
Jan R. Krause: Mit beiden Berufsgruppen bin ich viel im Gespräch: mit Architekten und mit Bauingenieuren. Ich habe den Eindruck, beide haben unterschiedliche Erwartungshaltungen und unterschiedliche Bedürfnisse. Bei den Architektinnen und Architekten sehen wir eine gewisse Neugier, KI als kreativen Sparringpartner zu entdecken. Bei den Bauingenieuren scheint es stärker um Effizienzsteigerung zu gehen. Jetzt stellt sich die Frage, wie lassen sich im Ingenieurwesen, wo alles durch Formeln belegbar ist, noch Effizienzen steigern? Wie lassen sich hier noch Systeme optimieren? Da gibt es einen gewissen Widerspruch: Wenn der Vorteil von KI die Verarbeitung einer großen Datenmenge und die Integration von viel Varianz ist, um damit zu optimierten Ergebnissen zu kommen, kann das für den architektonischen Entwurfsprozess interessant sein. Im Ingenieurwesen hingegen ist diese Varianz wenig zielführend, denn Varianz bedeutet dort eine Abweichung vom Optimum.
Michael Schuster: Dann müssen wir vielleicht noch einmal grundsätzlich über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Architektur reflektieren. Bei Architekturwettbewerben gleicht kein Entwurf dem anderen. Wie wird sich wohl der Einsatz von KI auf das Wettbewerbswesen auswirken, wenn verschiedene Architekturbüros die gleichen KI-Tools einsetzen und die Aufgabenstellung als Prompts eingeben. Werden sich die Ergebnisse dann nicht alle gleichen? Werden wir durch KI Variantenvielfalt verlieren?
Jan R. Krause: Wenn man nur die Wettbewerbsausschreibung in die Künstliche Intelligenz einspeist, dann könnten vielleicht ähnliche Ansätze rauskommen. Aber als Architekten lesen wir bei einer Wettbewerbsauslobung ja zwischen den Zeilen und gucken, welche besonderen Qualitäten wir anstelle reiner Funktionserfüllung an einem gegebenen Ort für eine spezifische Nutzung schaffen können. Und so werden wir die KI‘s prompten. Wir werden der KI maßgeschneiderte Fragen und Aufgaben stellen, um maßgeschneiderte Antworten zu bekommen.
Michael Schuster: Lass uns wieder auf das Bauingenieurwesen zurückkommen. Welche Vorteile bringt der Einsatz von KI im Engineering?
Jan R. Krause: Im Ingenieurwesen geht es um die Errechnung von Ergebnissen anhand von bestimmten Randbedingungen. Die Randbedingungen werden formuliert, die spezifischen Aspekte werden adressiert und dann wird nach bestimmten Standards gerechnet. Die parametrische Modellierung wird schon lange praktiziert. Auf diese werden jetzt optimierungsfähige Modelle aufgesetzt mit KI‘s, die zu interessanten strukturellen Varianten führen können.
Michael Schuster: Wie lässt sich im Ingenieurwesen Sicherheit durch KI schaffen?
Jan R. Krause: Es könnte sein, dass es bei sicherheitsrelevanten Entscheidungen für Ingenieure eine große Chance oder ein großes Risiko gibt. Die große Chance kann genau darin bestehen, weil alles reguliert, regelbasiert und genormt ist, dass wir zu beschleunigten Prüfverfahren kommen. Wir könnten KI unterstützt Pläne lesen und überprüfen, ob regelkonform geplant und gerechnet ist. Das Risiko in sicherheitsrelevanten Planungsprozessen und Entscheidungen besteht darin, dass die KI beginnt zu halluzinieren. KI-Modelle, die auf Deep Learning basieren, machen Entscheidungsprozesse für Menschen schwer nachvollziehbar. In sicherheitskritischen Bereichen wie der Tragwerksplanung ist diese Intransparenz problematisch, da Ingenieurinnen und Ingenieure die Verantwortung für die Standsicherheit der Gebäude tragen. Die größeren Vorteile von Künstlicher Intelligenz ergeben sich derzeit während der Bau- und Betriebsphase. Bildbasierte Baufortschrittsüberwachung, Robotik auf Baustellen, Unterstützung im Facility-Management und die Optimierung der Energieverbräuche sind Einsatzgebiete, in denen KI‘s Effizienz und Qualität steigern können.
Michael Schuster: In der Tragwerksplanung ist der Mensch also immer noch besser als die KI?
Jan R. Krause: Michael Maas, Professor für Tragwerkplanung an der Hochschule Bochum, bei dem wir heute zu Gast sind, hat dazu etwas Interessantes gesagt: Seit Piranesi ist das optimale Tragwerk eigentlich bekannt. Bei Hängekonstruktionen ist es das Seil, die Parabel, bei Stützkonstruktion ist es der Bogen. Und seit Jahrhunderten wissen wir, wie das Fachwerk funktioniert. Und trotzdem gibt es natürlich eine ganze Reihe von statischen Berechnungen, Differenzialgleichungen, finite Elementemethoden, die Ingenieure immer weiter entwickeln und erforschen, um zur Optimierung von Tragwerken größerer Komplexität zu kommen. Wenn wir über das Tragwerk sprechen, sprechen wir aber nicht nur über die statische Dimensionierung, sondern wir sprechen auch über die strukturelle Konstellation.
Und hier sind wir an der interessanten Schnittstelle zwischen Ingenieurwesen, Tragwerksplanung und architektonischem Entwurfsprozess. Als Architektinnen und Architekten wünschen wir uns Tragwerke, die zu unserem Entwurf passen und nicht nur ein physikalisches Optimum erzeugen. Da können KI‘s inzwischen sehr gut eingesetzt werden, um von einer Gebäudeform zu dem angemessenen Tragwerk zu kommen. Das gilt sowohl für weitgespannte Konstruktionen als auch für Hochhäuser.
Michael Schuster: Was kann denn Künstliche Intelligenz hier konkret optimieren?
Jan R. Krause: Die Materialwahl und auch die Bauweise rücken im Entwurfsprozess immer weiter nach vorne. Wird es ein Massiv-, ein Skelett- oder ein Modulbau? Wird es ein Holz-, ein Beton- oder ein Stahltragwerk? Das sind Optionen, die wir jetzt in Verbindung mit dem Entwurf viel früher und viel schneller variantenreich durchspielen können mit all ihren konstruktiven, statischen, ökonomischen und ökologischen Auswirkungen.
Michael Schuster: Außer für das Tragwerk sind Ingenieure auch für das Einhalten zahlreicher weiterer Sicherheitsvorgaben zuständig. Ich denke zum Beispiel an den Brandschutz. Wie können KI‘s die Planenden hier unterstützen?
Jan R. Krause: Prof. Dr. Ernst Rank vom Georg Nemetschek Institute of Artificial Intelligence for the Built World an der TU München berichtet, dass maschinelle Lernverfahren, die zur Raumklassifizierung und zu Modellprüfungen entwickelt wurden, die Konformität von Gebäudeentwürfen mit entsprechenden Bauvorschriften automatisch überprüfen können. Ein Beispiel ist die Prüfung von Entwürfen bezüglich der Einhaltung von Regeln des vorbeugenden Brandschutzes. Aber auch für den Brandschutz im Betrieb bieten KI-gestützte Brandmeldesysteme in Verbindung mit Sensoren und hoch auflösenden Kameras Vorteile. So lässt sich in Kombination aus Temperaturmessung und Rauchentwicklung ein Frühwarnsystem entwickeln, um entstehende Brände schnell zu erkennen und lokalisieren oder sie auch schnell von einem Fehlalarm zu unterscheiden.
Michael Schuster: Könnte der KI-gestützte Abgleich mit den gültigen Bauvorschriften auch einen Vorteil bringen beim modularen und seriellen Bauen, wenn es darum geht, in unserem föderalen System Lösungen von einem Bundesland auf ein anderes zu übertragen?
Jan R. Krause: Solange wir keine Harmonisierung der Landesbauordnungen haben, ist das sicherlich eine Chance, um Unterschiede einfach zu identifizieren und dann die Lösungen standortspezifisch anzupassen.
Michael Schuster: Kann KI auch Feuchteschutz?
Jan R. Krause: Der größte Feind des Architekten ist das Wasser. Wasser von oben, Wasser von der Seite, Wasser von unten und manchmal auch Wasser von innen. Das Eindringen von Feuchtigkeit ist insofern tückisch, weil wir es meist zu spät bemerken und oft nicht erkennen können, wo der Schadensfall ist. Die Eintrittsstelle und die Undichtigkeit sind bekanntlich nicht immer dort, wo der Wasserschaden sich im Innenraum abbildet, weil das Wasser sich in der Wand oder im Dach verteilt. Feuchteschäden sind aber auch nicht immer sichtbar. Es reicht schon, dass die Dämmung unbemerkt durchfeuchtet und ihre Dämmleistung nicht mehr erfüllt. Das Fraunhofer Austria hat an unterschiedlichen Dachtypen mit mehreren tausend Messpunkten Daten aufgenommen und diese systematisch analysiert. Künstliche Intelligenz wird dabei zur Diagnose und Prognose eingesetzt. Eine verlässliche Bewertung und eine kontinuierliche Überwachung des Dach-Zustandes sollen dazu führen, zu entscheiden, ob die Dachkonstruktion bereits zu feucht ist oder ob sie noch rücktrocknen kann. Mit dieser Überwachung kann eine Entscheidung getroffen werden, ob bzw. wann ein Dach saniert werden muss und ob der Abriss vermieden werden kann.
Michael Schuster: Wie weit ist der Weg von der Forschung in die Praxis?
Jan R. Krause: Es gibt bereits Monitoringsysteme für die strukturelle Überwachung von Feuchtigkeit und Temperatur im Flachdach, um Feuchteschäden frühzeitig zu erkennen und Sanierungskosten klein zu halten. Mittels Sensoren werden kontinuierlich die Feuchtigkeits- und Temperaturentwicklung im Flachdach gemessen und digitalisiert. Alle Informationen zur Beurteilung der Funktionsfähigkeit des Daches werden so in Echtzeit bereitgestellt. Dies kann gerade bei den immer komplexeren Anforderungen an das Dach eine Rolle spielen: Dächer sollen begrünt sein, Regenwasser speichern, Energie erzeugen. Da gibt es Schadensanfälligkeiten, die sich nicht mit dem bloßen Auge erkennen lassen.
Michael Schuster: Zu den ökologischen Anforderungen der Gebäudehülle zählt auch der Wärmeschutz. Wie kann KI dazu beitragen, Energie zu sparen?
Jan R. Krause: Der Energieversorger Vattenfall berichtet, dass KI-Technologie den Energieverbrauch in Gebäuden bereits um 20 % gesenkt und den Stromverbrauch von Mobilfunknetzen halbiert habe. Ein entscheidender Vorteil ist die KI-gestützte Anpassungsfähigkeit der Systeme, um den Energieeinsatz genau dort zu optimieren, wo sie gerade gebraucht wird. Im Haus lassen sich Sensoren installieren, die kontinuierlich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in verschiedenen Räumen messen. Kombiniert mit Daten zur Außentemperatur und Energiezufuhr für Heizung und Lüftung ergibt sich allmählich ein Muster, wie Wetter und Energieeinsatz das Raumklima beeinflussen. Das KI-System kann auch Daten über das vorhergesagte Wetter einbeziehen und damit Heizung und Belüftung entsprechend anpassen und dazu beitragen, Energieverschwendung zu vermeiden.
Michael Schuster: Dieser KI-Einsatz im Gebäudebetrieb klingt vielversprechend. Aber wie sieht es aus mit KI für die nachhaltige Gebäudeplanung?
Jan R. Krause: Mit dem Wärmeschutz einher geht auch die Gesamtbetrachtung eines Gebäudes über den gesamten Lebenszyklus. Mit KI-Tools wie keeValue, Revalu oder one-click LCA lassen sich entwurfsbegleitend Ökobilanzen ermitteln. Das sind wichtige Instrumente für Architekten und Ingenieure, um frühzeitig Planungsentscheidungen für Neubau oder Sanierung bewerten zu können in ihren Umweltauswirkungen über die gesamte Lebensdauer des Gebäudes. In Dänemark ist diese Ökobilanzierung bereits seit zwei Jahren verpflichtender Bestandteil beim Einreichen eines Bauantrags.
Michael Schuster: Wäre die KI angesichts der Menge an Daten nicht auch eine bahnbrechende Technologie für die Aufsichtsbehörden?
Jan R. Krause: Das ist natürlich die große Hoffnung, dass KI-gestützte Prüfungen der Gebäudeplanung die Genehmigungsverfahren beschleunigen werden. Noch wird vielfach beklagt, dass die prüfenden und genehmigenden Behörden gar nicht die Ausstattung und das Know-how haben, um diese digitalen Modelle auszulesen und die entsprechenden Prüfungen durchführen zu können. In Dänemark, Finnland und Japan ist das weit fortgeschritten. Da werden keine Ordner mehr von Abteilung zu Abteilung weitergereicht. Aber auch in Deutschland gibt es ja bereits Pilotprojekte für den digitalen Bauantrag per BIM-Modell. Ich denke, dass sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren deutlich beschleunigen wird.
Michael Schuster: Wie siehst Du die Zukunft im Ingenieurwesen in Zeiten von Klimawandel und Künstlicher Intelligenz?
Jan R. Krause: Aus meinen Gesprächen mit Ingenieurbüros höre ich zwei Stimmen. Die einen sagen, wir kommen mit unseren Instrumenten ganz gut klar. Die anderen sehen großes Potenzial und neue Geschäftsmodelle, indem sie als Ingenieure ganzheitlichere Ansätze anbieten als nur die Statik oder nur die Haustechnik oder nur die Lebenszyklusanalyse. Die Chance liegt darin, diese Dinge in Kombination anzubieten. Dann kommen wir unweigerlich zu KI-gestützten Daten, Auswertungen, die helfen, alles zusammenzuführen und in ihren Wechselwirkungen zu beurteilen. Das ist, glaube ich, eine Zukunft des Ingenieurwesens, die ganz interessant wird: weg von der Trennung der Disziplinen hin zu einem holistischen Ansatz, durch den die vielfältigen Aspekte in ihrer Wechselwirkung betrachtet werden und zu verantwortungsvollen Entscheidungen führen. Die lebenszyklusorientierte Sichtweise auf Architektur und Konstruktion durch KI-Unterstützung ist ein Paradigmenwechsel in der Baubranche.
Michael Schuster: Wird KI-Technologie auch die Disziplinen Bauingenieurwesen und Architektur wieder näher zueinander bringen?
Jan R. Krause: Als Beruf werden beide Disziplinen ihre Daseinsberechtigung behalten. Es geht um Expertise und um ein hohes Maß an Verantwortung: gestalterisch, konstruktiv, ökonomisch und ökologisch. Der Einsatz von KI-Technologien kann aber dazu führen, die beiden Welten von Architektur und Ingenieurwesen wieder zu verheiraten, eine kreative Ingenieurkompetenz und eine konstruktive Gestaltungskompetenz zu entwickeln. Ich glaube, dass KI‘s dabei helfen können, die andere Disziplin besser zu verstehen oder sich gelassener auf die Expertise der anderen Seite einzulassen, weil wir besser mit sich ändernden Randbedingungen umgehen und variantenreichere Szenarien – vielleicht auch für zunächst unmöglich gehaltene Varianten – erproben und faktenbasiert größere Komplexität beurteilen können. Das eröffnet, glaube ich, für beide Disziplinen interessante neue Perspektiven.
DBZ 06-2025: KI für Nachhaltiges Bauen
DBZ 07/08-2025: KI für die Resiliente Stadt
Rückblick
Zuletzt erschienen in dieser Reihe
DBZ 04-2025: KI-Einsatz beim Bauen im Bestand
DBZ 03-2025: KI Innovationen
DBZ 01/02-2025: KI International DBZ 12-2024: KI Einstieg in den Dialog
Sonderteil
DBZ 01/02-2025: Der große KI-Überblick mit Glossar