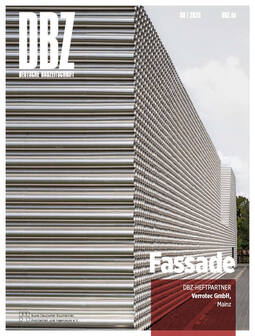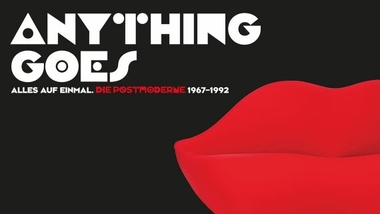Hoffentlich klimaneutral demnächst. Ausstellung in Bonn
1954 veröffentliche der Goverts Verlag den Koeppen-Roman „Das Treibhaus“, 70 Jahre ist das her. Das, was Koeppen damals und durchaus skandalisierend beschrieb, ist die Enge der noch jungen bundesrepublikanischen Hauptstadt und die Politblase, in der u. a. die ewig Gestrigen mit den jungen Heutigen ihre Gefechte austragen. Das ist in Bonn Schnee von gestern, heute kommt von hierher auch frischer Wind in die Republik. Kongresse, Ausstellungen … Wir schauten uns eine aktuelle an.
Wer heute durch Bonn reist und dabei Berlin vor Augen hat, kann nicht glauben, was Wolfgang Koeppen hier zur Romanvorlage nahm, was er erkannte! Zwar sind immer noch ein paar Bundesinstitutionen (2. Ranges) hier ansässig, aber Politik wird, mit all ihren formellen wie informellen Strukturen, mit den Hinterzimmergesprächen und offenen Schlagabtausch in der schönen Rheinstadt nicht mehr gemacht.
Was der Stadt erlaubt, viele Dinge, die im neuen Treibhaus Berlin verhandelt werden, mit größerem Abstand anzuschauen und zu hinterfragen, zu kommentieren, auch, sie konstruktiv zu begleiten. Ohne dabei im Verdacht zu stehen, für wen auch immer mit ökonomischer Zielrichtung zu lobbyieren. So ist – und wir schauen auf das Bauen – die Stadt mit dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung BBSR mit einer Bundesinstitution gesegnet, die zwar die gerade handelnde Politik berät, dazu aber auch unabhängig forscht und beispielsweise mit dem
biennalen Kongressformat „Zukunft Bau“ seit 2019 durchaus und immer wieder die Benchmarks der Bundespolitik wenn nicht bloß überspringt dann doch ordentlich weitet. Nachhaltig? Vielleicht noch nicht, aber die Impulse, die von dem Kongress ausgehen sind in der Bundeshauptstadt nicht einfach zu überblenden.
Dass neben – oder im aktuellen Fall – mit dem BBSR auch die Bundeskunsthalle deutlicher denn je Position bezieht, freut sehr. Gerade die aktuell gezeigte Ausstellung „WEtransFORM. Zur Zukunft des Bauens“, die noch bis zum 25. Januar 2026 läuft, ist dem aktuellen Diskurs zum neuen Bauen verpflichtet; deutlicher, als wir das in den letzten Monaten in Häusern erleben konnten, die viel näher dran sind am Thema des Bauens selbst.
Mitten im Diskurs und so weiter und so fort
Im Gespräch mit der Intendantin des Hauses und Teil des kuratorischen Teams der Ausstellung, Eva Kraus, betonte diese – auf die Frage, ob eine Kunsthalle nicht mehr der Kunst und weniger dem richtigen Bauen verpflichtet sei –, dass sie eine solche Ausstellung auch deshalb planen würde, „um virulente Themen der ökologischen Nachhaltigkeit, die auch in der Kunstszene stark verhandelt werden, im Programm abzubilden. Es gibt extrem viele Künstlerinnen, die interessieren sich für Nachhaltigkeit, für Diversität, für Soziales, für verschiedene politische Themen, für gesellschaftlich relevante Themen. Da geht es um Fragen der Natur, der Ausbeutung, der gesellschaftlichen Veränderungen, der sozialen Frage und so weiter und so fort. Mit diesen Künstlerinnen setzten wir unsere Projekte hier auf und sind mitten im künstlerischen Diskurs“. Und wirklich, ausgehend davon, dass sich das Kunsthaus programmatisch weiterentwickeln will/muss, widmet sich die Bundeskunsthalle in diesem Jahr der ökologischen Transformation.
Auch das steht auf einer langen Ausstellungspraxis, bereits bei der Eröffnung im Jahr 1992 zeigt die Bundeskunsthalle die Ausstellung „Erdsicht – Global Change“, die sich mit Klimawandel und Bevölkerungswachstum befasste. Es folgten u. a. „Future Garden“, eine Ausstellung zu Biodiversität oder die Ausstellungen „Arktis – Antarktis“ sowie „Wetterbericht“, die sich beide mit der Veränderung von Landschaft und Weltklima befassten.
Ein wichtiger Schwerpunkt des diesjährigen Themas der ökologischen Transformation ist das internationale Ausstellungsprojekt zu nachhaltiger Architektur und Stadtentwicklung in Europa „WEtransFORM. Zur Zukunft des Bauens“. Das sich als Wissensvermittler deklarierende Haus möchte mit dieser Ausstellung, die in enger Partnerschaft mit „New European Bauhaus“ und „transform.NRW“ entwickelt wurde – zu einer lebendigen Auseinandersetzung mit der Zukunft unserer gebauten Umwelt einladen. Im Mittelpunkt stehen grundlegende – und für Menschen, die schon länger in der Umbaudebatte dabei sind nicht neue – Gestaltungsprinzipien „für eine klimagerechte Erneuerung unserer Baukultur“. Diese Prinzipien werden in der Ausstellung auf den Themenfeldern Klimaresilienz stärken / Biodiversität fördern / Genügsamkeit üben / Bestand revitalisieren / Kreisläufe optimieren / Experimentieren wagen / Aktiv werden abgebildet.
Zu sehen sind rund 80 Projekte, die sich mit den Herausforderungen des Klimawandels beschäftigen. So versucht das Haus Glasner im Ahrtal (Studio Hertweck) sich vor künftigen Überflutungen zu schützen und das Rambla Climate House (Andrés Jaque / Office for Political Innovation, Miguel Mesa del Castillo) vor der zunehmend bedrohlicher werdenden Dürre in Spanien. Die Verwendung von natürlichen Materialien wie Stampflehm bei Anna Heringer oder Holz bei Hermann Kaufmann kann als eine wesentliche Antwort auf die philosophische Frage verstanden werden, was uns das Wesentliche im Leben ist. Es werden Projekte gezeigt, die mittels Renovierung und Umnutzung Ressourcenverbrauch, CO2-Ausstoß und Abfall vermeiden. Innovative Forschungsprojekte erkunden neue Möglichkeiten im Umgang mit zirkulären Materialkreisläufen oder computerbasierten Bauweisen.
Viele dieser Projekte wurden auch bei uns in den letzten Jahren gezeigt, der Hybrid-Flachspavillon wie auch der benachbarte Holzturm in Wangen sind in den letzten Heften ausführlich vorgestellt worden (DBZ 05|2025, Tragwerk).
Gang durch Katastrophenszenarien, die uns fast schon vertraut sind
Was die Medien allerdings nicht bieten können ist das Immersive, die körperlich wahrnehmbare zweite Schicht vor oder hinter den Bildern, Wärme, Feuchte, Gerüche, Geräusche, Tasterfahrung auf verschiedenen Materialoberflächen etc. „Also nur noch Texte anschauen und Fotos oder Zeichnungen, das reicht heute eben nicht mehr“, so Eva Kraus, „das wissen wir alle. Unsere Wahrnehmungskultur hat sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verändert. Konkret in dieser Ausstellung gibt es die ‚Interactiv Sun‘ von Marjan van Aubel. Hier können die Besucherinnen sehr entspannt die Simulation von Sonnenlicht erleben und zugleich dem Sound der Sonne lauschen. Die Sonnentöne wurden von der NASA aufgenommen und zu einer Soundwolke komponiert. Ein kontemplativer Raum, in dem es um die Fragen der Sonnenenergie oder der Energiepolitiken geht. Oder der Klimatunnel, eigentlich ein Gang durch Katastrophenszenarien in der Natur, die uns fast schon vertraut sind.“
Dann gibt es viel Material, Naturmaterial, das manchmal sehr künstlich erscheint oder sich zu künstlichen (Bau)Teilen fügt. Natürlich überall blinkende Screens, Kopfhörer. Viel Fotografie, aber auch Kunstarbeiten dazwischen, so „die herrliche Installation von mischer‘traxler Studio aus Wien. Da hocken Insekten in lampenähnlichen Glaskugeln, die hell werden, wenn man sich ihnen nähert und dann schwirren diese Insekten laut sirrend los. Das sind bedrohte, bereits ausgestorbene oder eben schrumpfende Insektenspezien und Populationen.“
Ihr Lieblingsprojekt ist das „Vert“ (Wortspiel mit „Grün“ und „vertical“) auf dem Museumsplatz – eine begrünte Holzbalkenkonstruktion von AHEC / Diez Office / OMC°C, die zur Kühlung von Plätzen und zur Stärkung der Artenvielfalt in städtischen Umgebungen beitragen soll. Im wunderbar weiten Foyer der Bundeskunsthalle selbst beeindruckt die bis zur Decke reichende Installation „Tree.ONE“ von EcoLogicStudio (Claudia Pasquero/Marco Poletto) – ein aus Mikroalgen gezüchteter, synthetischer Baum, der CO2 aus der Atmosphäre absorbiert und es in Biomaterial umwandelt.
Auf meine Frage, ob denn das Lieblingsprojekt nach Ende der Ausstellung wieder abgebaut wird, kommt ein Ja. Mein Hinweis, der doch sehr weite und meist auch öde Platz zwischen den beiden Ausstellungsvolumen könnte mehrere dieser „Vert“ gut vertragen beantwortet die Intendantin pragmatisch: „Nein, der Platz ist multifunktional angelegt und wird auch so genutzt. Wir haben immer Bedarf an vielen Installationen und Veranstaltungen, Performances und Konzerten und dergleichen. Da ist ein offener Raum mit einer wassergebundenen Decke äußerst hilfreich.“ Und man habe ja auch den Dachgarten, der als grünes Pendant zum Platz schon von Gus-tav Peichl gedacht sei. Für das Ausstellungsdesign insgesamt hat das Architekturbüro MVRDV (Rotterdam) fast ausschließlich auf bereits vorhandene Materialien in der Bundeskunsthalle zurückgegriffen, eine Strategie, die so langsam zum Standard zu werden scheint.
Aber ist das alles noch vermittelbar?
Und zum Schluss, den Katalog noch eingeschweisst auf den Knien, fragte ich nach dem Vermittelnkönnen der hier gezeigten Dinge. Ist die Transformation, die nicht nur auf das Bauen zielt, überhaupt darstellbar und am Ende allen vermittelbar? „Als Intendantin der Bundeskunsthalle denke ich immer, es muss für alle etwas dabei sein. Wir machen niederschwellige Angebote für den Laien genauso, wie für die Fachwelt interessante Projekte. Und da sind von Anna Heringer über Arno Brandlhuber bis Achim Menges die Größen der Planerinnenzunft dabei. Aber eben auch viele Künstlerinnen, Designerinnen, Universitäten, Forschungslabore wie „EcoLogicStudio“ beispielsweise, die mit dem Baum im Foyer eine regenerative Architektur entwickeln wollen. Das geht in viele Richtungen, sodass für alle hoffentlich genug Inspiration und neue Eindrücke dabei sind. Wir hatten schon viele Schulklassen hier, aber auch ein Publikum, was sehr nachhaltig neugieriger wird, aktiv in dieser Veränderung. Die Transformation insgesamt geht uns alle etwas an und da kann man viel lernen.“
Und weil ich es dennoch nicht in der Kulturarbeit eines Kunstmuseums untergebracht sehe, meine abschließende Frage: Ist der Umbau der Industrie und der Gesellschaft eine Sache der Hochkultur? „Ja und nein“, so Eva Kraus, „ich würde es eher Kultur nennen. Bei Thema der Nachhaltigkeit geht es immer um einen holistischen Ansatz. Ich kann die soziale Nachhaltigkeit nicht von der ökologischen trennen, die künstlerische nicht von der der Planung. Wenn wir von einer öko-sozialen Wende sprechen, haben wir auch immer eine kulturelle Veränderung im Großteil der Gesellschaft. Das Transformationsinteresse haben wir als Bundeskunsthalle auch. So haben wir, und sind noch dabei, zum Beispiel auch unsere Betriebsökologie umgebaut und versuchen, bereits 2035 nachhaltig klimaneutral zu werden, hoffentlich!“ ⇥Benedikt Kraft/DBZ
[WE/trans/FORM. Zur Zukunft des Bauens. Ausstellung in der Bundeskunsthalle Bonn, noch bis zum 25. Januar 2026,