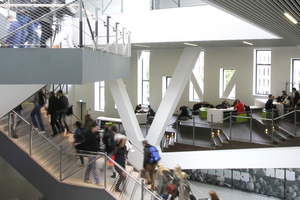Hochschulen: Gerüst, Organismus oder Club der Gleichgesinnten
Mit wem sprechen, wenn es um die Zukunft der (deutschen) Hochschulen geht? Wer hat hier den Überblick und: über was? Die Zukunft der Hochschulen habe längst begonnen, so eine These in dem hier nachfolgend wiedergegebenen Gespräch mit Martina Mellenthin Filardo und Hans-Joachim Bargstädt, Bauhaus-Universität Weimar. Auf Hans-Joachim Bargstädt hatte uns die Rektorenkonferenz hingewiesen, er habe hier den Überblick. Hat er auch, er und seine wissenschaftliche Mitarbeiterin, teils mit unterschiedlichem Fokus.
Zukunft der Hochschule in Deutschland: Warum, sehr geehrte Frau Martina Mellenthin Filardo, sehr geehrter Herr Professor Hans-Joachim Bargstädt, ist die von Ihnen beiden erwartbare detaillierte Binnensicht geeignet, Hochschulzukunft zu erkennen?
Hans-Joachim Bargstädt (HJB): Ich hoffe sehr, dass wir beide dazu etwas beitragen können! In den letzten 25 Jahre habe ich viele Veränderungen erlebt, habe das eher langsame Tempo der Baubranche und oft auch der Hochschulen kennengelernt. Ich konnte immer auch in das Innenleben anderer Fakultäten, anderer Hochschulsysteme schauen und dort beobachten, wie andere es anders, besser, aber auch weniger gut machen. So habe ich zumindest für die Vergangenheit ein tieferes Verständnis, von dem aus ich auf das blicke, was noch kommt, was ich noch beeinflussen möchte.
Martina Mellenthin Filardo (MMF): Ich habe mit Studium und dem Übergang zur wissenschaftlichen Tätigkeit an der Universität mehr als 15 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Rollen und an unterschiedlichen Fakultäten. Hier habe ich bis heute sehr konkrete Einblicke in die Entwicklung, auch in die Veränderungen, die die Hochschule prägen. Meine Wahrnehmung speist sich aus unterschiedlichen Perspektiven, was hoffentlich für einen Blick in die Zukunft hilfreich sein kann.
Nun haben Sie beide das Stichwort „Veränderung“ zu Ihrer Wahrnehmungsgeschichte genannt: Können wir Hochschule als einen Organismus anschauen, der von Menschen geformt, definiert, vorausgesetzt wird? Hochschule als Organismus?
MMF: Als einen Club?! Einen Club der Gleichgesinnten. Natürlich gibt es nicht den Club, dafür haben Universitäten zu unterschiedliche Profile, unterschiedliche Disziplinen, Schwerpunkte etc. Aber ich würde sagen, dass über alles hinweg ein gemeinsames Interesse vorhanden ist.
Hochschule als Club Gleichgesinnter … Was wäre das Gemeinsame?
HJB: Aus meinem Erleben ist Hochschule ein Raum, in dem eine entscheidende Phase der Weiterentwicklung junger Menschen stattfindet. Hier werden Freundschaften fürs Leben geschlossen, hier kann man sich selbst suchen und – im besten Fall – finden, kann sich seiner Fähigkeiten bewusst werden. In diesem sehr speziellen und komplett neuen Umfeld können Studierende weitestgehend frei entscheiden, was sie tun wollen und wohin sie ihre Reise führt.
Eine idealisierte Sicht? Ich habe Hochschule auch anders erlebt, mit durchaus rigiden Vorgaben, die nicht nur Spreu vom Weizen trennten, sondern als abstrakte Reviermarkierungen auch begabte Motivierte zurückschrecken ließ. Wunschkonzert war und ist das nicht!
MMF: Das ist richtig. Und wenn wir Universität auch als Welt betrachten,
passt die Floskel von „Das Leben ist kein Wunschkonzert“ bestens. Dennoch hat man viel Freiheit, auch die, nach dem Testen der „Prüfungshürden“, wie Sie sagen, zu erkennen, dass man vielleicht etwas anderes studieren sollte.
HJB: Gehen wir noch einmal zurück zum Bild vom Club: Jeder Club, der zur Party einlädt, muss ein Angebot machen, damit die Party erfolgreich wird. Ähnlich könnten wir die Rolle der Professorenschaft sehen, mit dem richtigen Angebot von Persönlichkeiten und Lehrinhalten den Hörsaal zu füllen.
Jetzt haben Sie beide die Hochschulen als lebendige Organismen beschrieben. Wie würden Sie eine Hochschule systemisch darstellen?
HJB: Ich schaue in diesem Kontext beim Wort Hochschule gerne auf den zweiten Teil: „-schule“ als den Ort der Vermittlung. Hochschule ist darüber hinaus der Ort, der sich für Forschung und Lehre, aber auch für die Freiheit von Gedanken und Ideen positioniert. Wir pflegen nicht umsonst die Errungenschaft der Selbstverwaltung mit Senat, Fakultätsrat, Studierendenvertretung und anderem, die wesentlich sind für eine Charakterisierung der – zumindest deutschen – Hochschulen. Dazu tritt der Wissenstransfer über die Kopplung von Forschung und Lehre.
Das klingt jetzt alles sehr sympathisch, dass ich gleich selbst eine Hochschule gründen möchte. Wie mache ich das?
HJB: Als Erstes suchen Sie sich extrem intrinsisch motivierte Kollegen, die eine Hochschule zusammen mit Ihnen aufbauen wollen. Ich begleite aktuell den Gründungsprozess der Technischen Universität Nürnberg, UTN, die erste Neugründung einer staatlichen Universität in Bayern seit 1978. Da spürt man hinter all den super Motivierten kaum noch das Formale, die Berge von Anträgen oder Genehmigungsverfahren …
Und nicht zuletzt: Es muss natürlich jemanden geben, der die Hochschule auch wirtschaftlich trägt. Das gelingt manchmal durch strukturpolitische Ziele in einem Bundesland. Da will man strukturschwache Regionen aufwerten, weil Hochschulen auch bessere wirtschaftliche Entwicklung verheißen.
Geht es den Öffentlichen nur ums Geld oder verschiebt sich aktuell der Fokus in der Förderung?
HJB: Die Politik fokussiert sich in meinen Augen immer wieder auf das strukturpolitisch Besondere. Im privaten Bereich beobachten wir gut nachgefragte „Business Schools“, die sich offenbar gut auf das gewünschte Zeitmanagement der häufig bereits berufstätigen Studierenden einstellen. Spannend sind aktuelle private Neugründungen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels. Private Hochschulen, so sehen wir es jedenfalls im Akkreditierungsprozess, sind sehr schnell darin, neue Nischen zu besetzen und damit natürlich auch Geld zu verdienen.
MMF: Das gilt auch für neue Studiengänge, die sich sehr fokussiert mit Umweltfragen befassen.
Sehen wir der Privatisierung der Bildungslandschaft zu? Wird Hochschule noch mehr zum Ausbildungsort weniger Privilegierter?
HJB: Nein, das ist weiterhin ein großes deutsches Privileg, dass wir den meisten jungen Menschen Lehr- und Denkfreiräume nahezu kostenfrei zur Verfügung stellen. In China habe ich das Massengeschäft akademischer Ausbildung erlebt und gesehen, wie dort uniforme Lehre zum Einsatz kommt, um einfach die große Anzahl der Bildungshungrigen zu bewältigen.
Gibt es Trends, gibt es Fächer, die mal sehr gut nachgefragt und dann in dieser Position von anderen abgelöst werden? Sind solche Trends politisch, gesellschaftlich oder sonst irgendwie gesteuert?
MMF: Ob es Trends gibt, ist mit Blick auf die Gesamtzahl der Universitäten und Hochschulen schwierig zu sagen. Aber es gibt ganz sicher Wellen …
… die sich am Markt orientieren? Angebot, Nachfrage? Zu meiner Zeit waren Informatiker gefragt – heute wieder! Meine Eltern hatten mir, lange her, das Kunststudium verboten, weil da nichts aus mir werde!
HJB: Doch, es gibt klare Trends und auch Moden. Eine Frage ist: Wo läuft Forschung, wo wird Forschung unterstützt? Mit Landesprogrammen, BMBF-Programmen. Wenn da Geld ist, kommen auch die Forschenden, und wenn sich das verstetigt, schwappt das Thema auch in das Lehrangebot über.
Die andere Frage ist, wie gewinne ich, Trend hin oder her, mehr Studierende? Das wird zukünftig wohl die wichtigere Frage sein, die Attraktivität der Hochschule für mehr Studierende. Wer hier nichts anzubieten hat, fällt bei der Anzahl eingeschriebener Studierender zurück. Und das kann schwierig werden für einzelne Hochschulen!
Hochschulen sind immer auch aufgefordert, Trends vorauszusehen. Aber selten wird ein neuer Studiengang freihändig und ins Blaue aufgelegt.
MMF: Aber wie bei Architekturepochen und ihren Stilen gibt es bei den Hochschulthemen wiederkehrende Wellen. Ich erinnere mich an bestimmte Schwerpunktprogramme im Master, die zu eigenständigen Studiengängen und mit der nächsten Welle wieder im Master zusammengefasst wurden. Ich habe das Gefühl, dass alle X Jahre die gleichen Gespräche wiederkehren. Vielleicht auch, weil ehemalige Studierende mit ihren Ideen an die Hochschule zurückkommen und hier mit ihren Erfahrungen anknüpfen?!
HJB: Prinzipiell brauchen wir Veränderung, wir brauchen Neues, damit wir geistig und organisatorisch beweglich bleiben, uns nicht zu bequem einrichten oder innerlich zur Ruhe setzen.
Wieder grundsätzlicher: Was ist der Bildungsauftrag der Hochschulen?
MMF: Da greife ich auf Ihre Heftgliederung zurück: Forschung und Lehre sind der Auftrag. Die von Ihnen noch dazugestellte Praxis ist bei uns der Transfer. Steht in der Gesetzgebung der Länder.
HJB: Als Hochschullehrer kommentiere ich: Wir sollen die Freiheit von Forschung und Lehre vermitteln. Und – auch das ist gefordert, aber längst nicht selbstverständlich – wir haben die Pflicht, die Studierenden zu einer vernünftigen Berufsfähigkeit zu führen. Das impliziert auch, dass der Beruf relevant ist für die Gesellschaft, dass er einen Mehrwert bringt.
Womit die Hochschulen also neben dem Erfahrungszugewinn – nennen wir es geistige Reife – auch Menschen entlassen sollten, die im Leben stehen und gleichzeitig hoch (aus-)gebildet sind?
HJB: Immer sollte beides bedacht werden. Das eine vom anderen zu trennen ist unmöglich. Wenn jemand einem sehr straffen Studienplan folgt, so soll er das gern. Wir verwehren es nicht. Aus meiner Sicht wäre das aber zu wenig. Denn wir wollen unseren Studierenden zugleich ausreichende Freiräume der Entfaltung bieten. Eine wiederkehrende Kernfrage ist: Was gehört zum Basislehrstoff im Grundstudium? Es muss Fachvermittlung hinein und die Möglichkeit, sie gleich auch anwendungsbezogen einordnen zu können. Spaß machen muss ein Studium und Enthusiasmus entfachen.
Kollaborativ und interdisziplinär stehen für das neue Zusammen von Lehre und Forschung, insbesondere bei den Ingenieurwissenschaften.
HJB: „Kollaborativ und interdisziplinär“ ist ein hoher Anspruch, der noch zu wenig umgesetzt wird. Schon das Auswahlverfahren bei der Berufung von Professoren setzt bestimmte Standards. Ein Professor/eine Professorin wird berufen, weil er oder sie gerade der oder die Beste ist. Sonst wären sie nicht berufen worden: „Ich bin der Beste im Fach und mein Fach ist das Wichtigste.“ Und danach soll dieser Professor den Studierenden sagen, dass Interdisziplinarität eigentlich das ist, was wir wirklich brauchen?! Dieser Widerspruch ist schwer zu lösen.
MMF: Vielleicht müssen wir aber auch unterscheiden, wo wir kollaborativ und interdisziplinär arbeiten. Im Projektstudium ist das selbstverständlich, aber das Curriculum wird immer noch nach einzelnen Professuren organisiert. Das mit der Zukunft ist auch so eine Sache: Manches vom heute Neuen finden wir doch bereits in der Vergangenheit.
Zum Stichwort „kollaborativ“ fällt mir das Bauhaus von vor 100 Jahren und sein Lehrkonzept ein. In einer Zeit der Akademie-Lehre, in der frontal, also eher eindimensional unterrichtet wurde, hat das Bauhaus als Sammlung von Werkstätten Schüler aufgenommen, die zusammen mit ihren Meistern gearbeitet haben.
Frontal kann aber auch heißen: Ich höre jemandem gebannt zu …
MMF: Ja, das gibt es, ist aber leider nicht die Regel – was vielleicht auch am zu lehrenden Stoff liegt. Würden wir nur noch frontal unterrichten, ginge der Lehrstoff aber meist hier rein und da wieder raus. Um Wissen dauerhaft zu festigen, muss es angewendet werden. Und dafür ist beispielsweise ein Projektstudium super.
HJB: An herausragende Vorträge, die man ein Leben lang nicht vergisst, erinnern wir uns sicherlich alle. Ein bahnbrechender Erfolg in der Lehre liegt – neben optimierter Vortragstechnik – möglicherweise auch darin, dass man sich traut, zu entschlacken. Etliche von uns stehen im Hörsaal und versuchen die gesamte Stofffülle zu vermitteln, manchmal unter Zeitdruck sogar ziemlich stoisch. Davon bleibt dann wenig hängen, das könnten automatisierte Lernprogramme viel besser. Also müssen wir eben die Reduktion fordern und auch: erlauben!
Kommen wir zu unseren drei Themenfeldern, in die die Redaktion das Hochschulthema aufteilte: Lehre, Forschung, Praxis. Gibt es hier einen roten Faden, gibt es Schnittstellen, übergreifende Aspekte?
HJB: Dass Forschung und Lehre gut zusammengehen, das scheint mir offensichtlich. Wie und wo können wir hier sinnhaft die Praxis ankoppeln? Im dualen Studium funktioniert Lehre mit Praxis wunderbar. An der Universität muss beim Praxistransfer nicht jede Professur mitmachen, nicht jeder Lehrstuhl muss praxisorientiert sein. Es gibt auch bei den Ingenieuren Elfenbeinturm-Forscher, die ihre Berechtigung haben.
MMF: Wenn ich auf die drei Themenfelder schaue, sehe ich im Hinblick auf die Entwicklung von Universitäten, Studiengängen und Schwerpunkten die Forschung vorne, leicht vor der Lehre. Hier wird in die Zukunft geschaut, was dazu führen muss, dass die Lehre nicht veraltet. Die Praxis, also der Transfer, der läuft parallel zu Lehre und Forschung und dockt hier regelmäßig immer wieder an. So können sich bspw. Start-ups gründen.
HJB: Das funktioniert tatsächlich gut, weil der Austausch zwischen Lehrenden, Forschern und Studierenden hier projektorientiert sehr intensiv ist. Start-ups sind nicht der einzige Transferweg, wir bespielen ganz viele Wege. Der langsamste Weg des Transfers ist, wenn ein Absolvent in die Wirtschaft geht und dort einfach nur sein aktuelles Wissen einbringt.
Forschung bedeutet doch immer auch Drittmittelakquise?!
HJB: Nein, Forschung ist für mich die Kombination von Gründlichkeit und Besessenheit! Forschung ist positive Besessenheit.
Aber ohne Drittmittel keine Forschung an der Uni?
HJB: Auf der Leitungsebene einer Universität wird das so gesehen, ja. Aber wir haben doch einen Blumenstrauß von ganz vielen unterschiedlichen Forschern. Die einen arbeiten im stillen Kämmerlein, die anderen ziehen mit ihrer Aura, also aufgrund ihres Rufs, begabte Studierende in ihren Bann. Sie forschen dann mit ihnen zusammen und veröffentlichen viel. Es ist bei den Ingenieuren üblich, Drittmittel zu akquirieren, aber es ist nicht per se ein Muss.
MMF: Bei Drittmitteln hat man oft die Hürde, dass man in Vorleistung gehen muss, man muss schon Referenzen – also Forschungsvorleistungen – haben. Das ist dann beispielsweise bei der Architektur schwieriger.
Ingenieure gelten als handfest und lösungsorientiert. Vielleicht werden sie deshalb anders angeschaut als die Kreativen?
MMF: Wobei die Drittmittel, die im Bauingenieurwesen unterwegs sind, hauptsächlich aus Förderaufrufen stammen, auf Bundes- oder Landes-ebene oder von bundesweiten Institutionen.
HJB: Bei den Bauingenieuren geht es häufiger um die Verbesserung der Lebensbedingungen – leistungsfähige Infrastruktur, innovative Baukonzepte, sichere Umwelt. Ganz aktuell begegnen uns derzeit, wie auch in anderen Ingenieurbereichen, die Stichworte „Resilienz“, „Wehrhaftigkeit“, „Kritische Infrastruktur“, aber auch Schutz des geistigen Eigentums und Schutz vor Preisgabe sensibler Daten.
Kommen wir zur Akkreditierung. Da sitzen Sie, Herr Bargstädt, ganz weit oben. Haben Sie das Gefühl, dass der Akkreditierungsrat eine Art konservativer Filter ist, der regelt, was in die Hochschulwelt hineingelassen wird?
HJB: Seit mittlerweile acht Jahren ist der Akkreditierungsrat das Gremium, das über alle Studiengänge endgültig entscheidet, ausgenommen Jura und Medizin. Das Gremium besteht aus 22 Personen, die aus vielfältigen Bereichen kommen, also die Wirtschaft, Ländervertreter, Hochschullehrer, Studierende und internationale Vertreter. Zu diesem 22-köpfigen Gremium kommen noch einmal etwa genauso viele Vertreter, die ebenso geschult sind, ganzheitlich darauf zu schauen, ob ein zur Akkreditierung vorgelegtes Studienprogramm funktioniert. Wir achten dabei darauf, ob eine Hochschule im vorauseilenden Gehorsam denkt, sie dürfe eigene Ideen nicht umsetzen. Meist sind die gesetzlichen Vorgaben so formuliert, dass sie weite Spielräume erlauben, häufig kann – mit nachvollziehbarer Begründung – von Vorgaben abgewichen werden. Also: Die Freiräume sind größer als es sich unsere Partner an den Hochschulen oft vorstellen. Manche Hochschulverwaltung beschränkt diese Freiräume ohne Not, indem sie aus einem „in der Regel“ ein „immer“ oder aus einem „Man sollte“ ein „Man muss“ macht.
Weil das mehr Arbeit macht?
HJB: Ja, Verwaltungen an Hochschulen lieben klare Strukturen und Ja/Nein-Entscheidungen. Dabei ist vieles erlaubt, eigentlich das meiste.
Akkreditieren heißt, dass sich eine Hochschule bei Ihnen bewirbt, beispielsweise mit einem neuen Studiengang?
HJB: Es gibt, vereinfacht gesagt, zwei Arten der Akkreditierung. Die eine ist die Programmakkreditierung, in der die Hochschule jeden Studiengang vorstellt.
Jeden Studiengang, den eine Hochschule neu bildet?
HJB: Ja, jeden und zwar alle acht Jahre durch die Reakkreditierung.
Das ist eine Art TÜV!?
HJB: Der TÜV prüft alle zwei Jahre eine ansonsten objektiv vorliegende Technik. Bei der Hochschulakkreditierung werden die Anträge zuerst durch eine unabhängige Akkreditierungsagentur geprüft oder begleitet, bewertet von Experten, die an die Hochschule kommen. Die Experten stehen ebenso wie die Hochschule in einem gemeinsamen lernenden System. Die Hochschule legt einen Selbstbericht vor. Die Experten erarbeiten dann eine Bewertung des Hochschulsystems einschließlich eigener Empfehlungen bis hin zu Auflagen zur Nachbesserung. Eine Akkreditierungsagentur fasst all das in einem Bericht zusammen und legt den Bericht dem Akkreditierungsrat zur endgültigen Entscheidung vor.
Die zweite Art der Akkreditierung ist die Systemakkreditierung. Dabei beantragt die Hochschule das Recht, ihre Studiengänge selbst zu akkreditieren.
MMF: Dafür muss man aber auch das Volumen haben, dass sich so eine Systemakkreditierung lohnt, oder?
HJB: Ja, das verlagert die Arbeit der Qualitätssicherung und -entwicklung von den Agenturen hin zur Hochschule. Dann hat man da zwei, drei Mitarbeiter mehr im Qualitätsmanagement der Hochschule.
Hat eine nichtakkreditierte Hochschule ökonomisch eine Chance?
HJB: Eher nicht. Die öffentliche Hand fragt bei Einstellungsverfahren nach akkreditierten Abschlüssen. Ohne diese gibt es oft keine Einstellung mehr. Der Privatwirtschaft ist das – noch?! – ziemlich schnuppe. Im Ausland ist Akkreditierung dagegen gang und gäbe.
Für mich hat Akkreditierung im Wesentlichen drei Aspekte: erstens verschriftlichte kritische Selbstvergewisserung; dazu kommt zweitens die Außensicht der Peers, die an die Hochschule kommen und sich mit den Lehrenden, Studierenden und weiteren Beteiligten vor Ort austauschen; und der dritte Aspekt ist der vergleichende Blick des Akkreditierungsrats, der verhindert, dass hier strengere, dort laschere Qualitätsmaßstäbe angelegt werden. Akkreditierungsentscheidungen sollen bundesweit ein vergleichbares Niveau haben.
Woran misst sich Qualität? Wie müssen sich Maßstäbe anpassen?
HJB: Qualitätsmaßstäbe legt jede Universität selbst fest. Die Franzosen beispielsweise kennen eine viersemestrige Classe Preparatoire. Das ist eine äußerst harte Mühle mit hoher Abbrecherquote. Das gehört zu deren Konzept der akademischen Bildung. Die Hochschulen legen also selbst fest, was sie wollen: ob sie elitär sein wollen, ob sie Main-Stream-Programme oder ob sie Förderprogramme auflegen für Schwächere. Und wir fragen dann beispielsweise kritisch: Wenn Ihr Elite-Studiengänge macht, was bietet Ihr Abbrechern an? Wie funktioniert ein Exit, was ist die Alternative?
MMF: Die Akkreditierungsagenturen sprechen mit den unterschiedlichen Gruppen an den Universitäten, auch mit Studierenden, mit Mitarbeitenden, mit Absolventen. Es wird nicht nur das, was über Zahlen aufbereitet ist, gewertet, sondern ein möglichst umfassendes Hochschulportrait.
Die Agenturen müssen europäisch akkreditiert sein?
HJB: Wenn sie das sind, können sie überall in Europa ihren Job machen. Und: Prinzipiell wollen wir auch in Deutschland ein europäisches, offenes Bildungssystem haben.
Stichwort „Konkurrenz“: Um überlebensfähig zu sein, müssen Hochschulen um Forschende/Studierende kämpfen.
MMF: Ja, aber man will sowohl Studierende als auch Forschende, was gar nicht so einfach ist im Augenblick. Jeder Rechtsruck, egal ob der auf Bundes- oder Länderebene feststellbar ist, zeigt den Hochschulen sehr schnell, dass sie weder Studierende noch Forschende aus dem Ausland locken können. Der politische Rechtsruck macht sich unmittelbar im universitären wie im Hochschulkontext insgesamt sofort bemerkbar.
HJB: Ich habe mich daran gewöhnen müssen, dass Fachkräftemangel auch akademischer Fachkräftemangel ist. Tatsächlich brauchen wir also mehr ausländische Studierende, vom Bachelor-Abschluss bis zum Master. In der Promotionsphase ist das aktuell eigentlich kein Thema, hier kommen Aus- und Inländer komplett gemischt an die Hochschulen.
Es gibt Hochschulen, die mittlerweile Probleme haben, weil sie ihre Studierenden nur aus einem bestimmten Ziel- oder Quellland bekommen. Das kann dann leicht kippen, und man hat plötzlich eine homogene Kohorte aus einem einzigen Herkunftsland. Hier wird es dann schwierig, unseren Integrationsauftrag zu erfüllen.
Bleiben wir noch bei der Akkreditierung. Welche Möglichkeiten sehen Sie beide, die genannten Studiengänge über die Akkreditierungsverfahren, über neue Studiengangskonzepte, andere Didaktiken, veränderte Kompetenzprofile etc. qualitativ voranzubringen? Reicht hier Optimierung? Alle acht Jahre zum TÜV ist wohl zu langsam?
HJB: Zunächst einmal heißt „für acht Jahre akkreditiert“ nicht, dass man in dieser Zeit nichts verändern darf! Im Gegenteil: Wir erwarten, dass sich die Hochschulen weiterentwickeln. Der Achtjahresrhythmus ist doch so etwas wie eine Qualitätsprobe zum Stichtag. Die Ansicht, man sei ja akkreditiert und dürfe acht Jahre lange nichts verändern, ist absolut falsch. Jederzeit kann man ändern. Aber will man denn überhaupt etwas verändern? Ich habe den Eindruck, manche Fakultäten warten damit immer so lange, bis ein Neuberufener mit neuen Konzepten die anderen aufmischt. Hochschulen haben alle Freiheit, sich selbst neue Konzepte zu geben. Sind das wesentliche Änderungen, sind sie dem Akkreditierungsrat vorzulegen, der meist zustimmt.
Klingt dennoch nach Antragskultur und Bürokratie. Wie werden wir schneller in der Entwicklung neuer Strukturen?
MMF: „Schneller“ führt häufig zu Gründungen auf der grünen Wiese. Das ist am Anfang verlockend, muss aber konsequent durchdacht sein, sonst vermehren sich die Studiengänge unkontrolliert und ohne Ziel.
Ich hatte auch eher daran gedacht, das Bestehende zu verändern, auf konkrete Rückmeldung der Studierenden zu reagieren, auf Vorschläge der Neuberufenen. In der Schule geht das definitiv nicht ...
HJB: Ja, mein Eindruck ist, in unseren Schulen geht das überhaupt nicht. Da sind große Arbeitsstäbe in den Kultusministerien beschäftigt und den restlichen Freiraum benötigen neu gewählte Minister zur eigenen Profilierung. Sehen Sie sich einmal im Schulsystem Neuseelands oder Australiens um, welche großen individuellen Freiheitsgrade dort bereits die Oberstufe in den Highschools gewährt.
MMF: An den Hochschulen gibt es schon Möglichkeiten, da ginge mehr, jederzeit. Wir haben hier die Studiendekane, die im Einbezug der Akkreditierungsprozesse das Curriculum anpassen können, ohne dass notwendige Standards davon negativ beeinflusst werden.
HJB: Aber zuallerst muss diese Freiheit zur Gestaltung entdeckt werden, sie muss gewollt sein. Es gab Hochschulen, die haben den Modulkatalog mit in die Prüfungsordnung gepackt, und das ging bei jeder kleinsten Aktualisierung dann durch die Gremien, also Fakultätsrat, Senat, Präsident, bis zur Veröffentlichung. Diese totale Festschreibung, die in den 1990er-Jahren auch noch seitens des Ministeriums verlangt wurde, ist in dieser schnelllebigen Zeit absoluter Unsinn. Hier in Weimar können wir den Modulkatalog halbjährig verändern. Das bringt Effizienz und Flexibilität.
MMF: Die Lehrenden verändern sich, die Studierenden verändern sich. Vielleicht kann man zwei Semester in Folge einen Kurs anbieten, der gut nachgefragt ist. In der dritten Auflage aber spreche ich mit ganz anderen Studierenden und plötzlich funktioniert die Vermittlung nicht mehr, Inhalte werden nicht mehr oder falsch verstanden. Warum? Die Studierenden haben andere Interessen, es gibt mit einem Mal andere Selbstverständlichkeiten und bereits hier kann Veränderung stattfinden.
Müssen die Inhalte oder eher die Didaktik angepasst werden, beides?
MMF: Zuerst ganz sicher die Didaktik.
HJB: Ich würde das Inhaltliche für wesentlich erachten. Didaktische Dinge zu verändern ist schwieriger, so schnell krempel ich mich nicht um. Ich bin, wie ich bin, und das ist gut. Der ideale Lehrende, der die Didaktik und den Lehrstoff standardisiert und optimiert vorträgt – so einen würde ich fürchten. Dann wäre jeder Lehrende identisch. Glücklicherweise haben wir noch das Privileg der Vielfalt! Wir kennen alle den etwas verschrobenen Professor X, der aber sehr gemocht wird von einer besonderen, ggf. auch nur kleinen Gruppe Studierender. Eine andere Kollegin zieht mit ihrer persönlichen Art andere an und so weiter. An welche drei Professorinnen oder Professoren erinnern Sie sich denn noch aus Ihrer Studienzeit?
Vielleicht an drei?
HJB: Genau, Sie erinnern sich nicht an 13, 18 oder an alle. Menschen – Lehrende wie Studierende – sind eben Individuen, sie sind verschieden, im Guten wie im Schlechten.
MMF: Ich könnte drei bis fünf nennen, die mich beeindruckt, vielleicht auch geprägt haben. Aber noch mal zur Geschwindigkeit in der Anpassung oder Entwicklung: Ich glaube nicht, dass wir das Hochschulsystem immer wieder neu erfinden sollten. Wir sollten vielmehr ein Gerüst schaffen, das den einzelnen Studiengängen Sicherheit verleiht für die Studierenden, für die Lehrenden und für die Schwerpunkte, die man für Kernkompetenzen in den Berufen später braucht. Innerhalb dieser Kernkompetenzen – ich nenne diese jetzt Fächer – sollten wir so viel Freiraum anbieten, dass neuere Inhalte jederzeit gelehrt, dass neue Dinge erforscht werden können, ohne dass das Gerüst neu erfunden werden muss.
Ist das jetzt ein kleiner Blick in die Zukunft, also auf das, was wir gerne hätten? Oder ist Ihr „Gerüst“ schon da?
HJB: Wenn Sie eine gute Prüfungs- und Studienordnung haben, dann ist das alles dort schon weise angelegt. Ein Beispiel aus eigenem Hause: Eine Abschlussarbeit als Teamarbeit wurde vom Prüfungsausschussvorsitzenden mit dem Hinweis auf „Gruppenarbeit geht nicht“ abgelehnt. Ich zeigte ihm die Prüfungsordnung: Gruppenarbeit ist dort als alternative Form erlaubt! Teamarbeit ist Arbeiten, wie es im späteren Berufsalltag dringend benötigt wird. Wir sind vielleicht faul geworden darin, nicht einmal mehr nachzuschauen, was wir alles dürfen. Erlaubt ist alles, was nicht explizit verboten ist. Manchmal braucht es vor allem Mut, Überzeugung, eine Sache gegen Widerstände zu verteidigen. Was auch misslingen kann, aber das Risiko sollten wir eingehen.
MMF: Aber die Universitäten machen es uns nicht immer leicht, nachzuschauen und daraus die Schlüsse zu ziehen. Beispiel Promotionsordnungen: Auf den Fachkonferenzen im Rahmen meiner Promotion habe ich drastische Unterschiede an deutschen Hochschulen feststellen müssen, darunter die Gutachteranzahl, den Ablauf, die Notenvergabe usw. Diese Informationen erhält man meist nur durch Hörensagen. Die Prüfungsordnungen sind häufig nur hochschulöffentlich.
Das spiegelt die Konkurrenzsituation, in die sich die Hochschulen in Deutschland begeben haben. Interdisziplinarität, innerhalb einer Universität erwartet, gibt es bundesweit nicht. Forschung, wo gemeinsame Projekte eher und mehr Drittmittelförderung erhalten, funktioniert dagegen sehr gut.
Dann wären wir bei meiner vorletzten Frage. Wenn Sie die Zukunft der deutschen Hochschullandschaft in einem Satz beschreiben würden … Einmal als realistischen Zukunftsausblick, dann als Wunsch?
HJB: Ich fange mal mit dem Wünschen an. Ich wünsche mir und uns mehr Mut im Denken: beispielsweise auch in der Lehre mehr auszuprobieren, die Initiativen der jungen Lehrenden stärker zu unterstützen, mehr und gemeinsam Ideen entwickeln, wie man neue Konzepte in die Prüfungsordnung gegossen bekommt. Neue Formate könnten versuchsweise mit Credits bewertet werden ... Ich wünsche mir, kurz gesagt, dass wir nicht immer sofort sagen: Das geht nicht! Und auch, dass wir Studierende, die mit dem System nicht so gut klarkommen, früher an die Hand nehmen, ihnen den Einstieg und das Dabeibleiben leichter machen, aber auch den Exit.
Der realistische Ausblick ist, dass wir damit rechnen müssen, dass sich die Hochschulen weiter ausdifferenzieren, in Richtung agile und fortschrittliche und damit auch in nachgefragte Hochschulen und in andere Hochschulen, an die man geht, weil man dort schlicht einen Studienplatz bekommen hat. Diese Kategorisierung lässt in Deutschland bisher überhaupt keine Rückschlüsse auf die Qualitäten der Lehre zu, denn die kann wunderbar sein bei einer Hochschule, die kaum forscht, wenn sie nur wach bleibt und auf dem aufbaut, was andere bereits geforscht haben.
MMF: Ich teile den realistischen Ausblick. Beim Wunschausblick würde ich sagen, dass in Forschung und Lehre noch stärker die Themen Klimakatastrophe, Rechtsruck, gesellschaftliches Klima etc. in den einzelnen Lehrinhalten verankert werden. Das passiert schon, aber noch längst nicht überall. Und: Wir müssen hier dranbleiben, kein Greenwashing betreiben, die aktuelle Großproblemlage in der Lehre und in der Forschung adressieren. Das ist, glaube ich, das, was in nächster Zukunft zu lösen ist.
Jetzt meine letzte Frage. Welche Vorbildrolle könnten die Ingenieur- und die Architekturwissenschaften für andere Fakultäten übernehmen … Historiker und Theologen vielleicht ausgenommen?
HJB: Wir leben in Zeiten der Halbwahrheiten, sogar der Fake-News. Wir Ingenieure und Architekten sind es gewohnt, wissenschaftliche Ergebnisse zu hinterfragen und sie dann sehr pragmatisch umzusetzen.
MMF: Evidence-based, das zeichnet uns wohl aus. Ob wir hier aber ein Alleinstellungsmerkmal haben?!
HJB: Dazu kommt, dass wir in der Regel auf Kompromisse zuarbeiten. Und: Ingenieure gelten häufig als langweilig, weil sie langfristig denken. Mit Langfristigkeit und Sicherheit kann man kaum jemanden hinter dem Ofen hervorlocken. Architekten zeichnen sich durch ihre Auseinandersetzung mit unserem historischen Erbe aus, dadurch, dass sie sich mit der Identität von Stadtraum, von Geschichte beschäftigen, damit, woher wir kommen, was wir bereits geschaffen haben. Geschichte von Ingenieuren und Architekten anzuschauen bedeutet, dass wir unsere Infrastruktur, die Brücken, Gebäude, Kanäle, ganze Städte als Ausdruck unserer Kultur verstehen.
MMF: Ich glaube, die Architektur kann durch ihre holistische, ganzheitliche Denkweise zur Kultur einer Gesellschaft viel beitragen. Denn das An-alles-Denken ist in der Architektur zentral, in unserem gesellschaftlichen Leben nicht minder.
HJB: Das Ringen um eine allseits vernünftige Lösung, ein allseits vernünftiges und langfristig tragfähiges Konzept mit einem Hauch von Ästhetik, das sollte in Hochschulen wieder mehr ins Zentrum rücken … Falls es jemals dort war!?
Mit Martina Mellenthin Filardo und Hans-Joachim Bargstädt unterhielt sich DBZ-Redakteur Benedikt Kraft am 28. Oktober 2025 in Weimar.