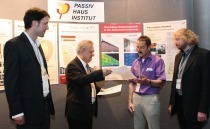Mit Brief und Siegel
Tue Gutes – und lass es dir zertifizieren. Vom Passivhaus- über DGNB-, BNB- und die internationalen LEED- und BREEAM-Standards gibt es heute zahlreiche Möglichkeiten für Ingenieurinnen und Architekten, sich die Nachhaltigkeit ihrer Arbeit belegen zu lassen – oder selbst zu dokumentieren. Doch für wen lohnt es, sich als Auditor ausbilden zu lassen oder im Zertifikatsmanagement weiterzubilden? Eine Einführung.
Deep Blue bezwingt Garry Kasparow – zum ersten Mal in der Geschichte besiegt ein Supercomputer einen amtierenden Schachweltmeister unter Wettkampfsbedingungen. In Schottland erblickt mit Dolly das erste geklonte Schaf das Licht der Welt. Und in Darmstadt gründet Wolfgang Feist das Passivhaus Institut. 1996 war ein Jahr der Umbrüche. Vor allem die Sache mit dem nachhaltigen Bauen kam in der Folge so richtig in Schwung – dank Wolfgang Feist und seinen Zertifikaten.
Heute haben Bauherrinnen die Qual der Wahl: Zum Passivhaus-Zertifikat gesellte sich ab 2007 das DGNB-Zertifikat, der Bund zog 2009 mit dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) nach, seit 2011 ist es Pflicht bei allen Bundesgebäuden und Pilotprojekten der Länder. Das 1998 in den USA entwickelte LEED-System schwappte in den 2010er-Jahren über den großen Teich. Etwa zur gleichen Zeit kooperierte die DGNB mit BREEAM, das inzwischen auch in Deutschland eigenständig auftritt. 2017 erhielt das EDGE Grand Central in Berlin als erstes Gebäude hierzulande eine Auszeichnung nach dem WELL Building Standard.
Kompetenz als Verkaufsargument
„Obwohl viele Nachhaltigkeitsstandards in Deutschland weit verbreitet und nachgefragt sind, bin ich immer wieder verwundert darüber, wie wenig Architektinnen und Architekten oft darüber wissen“, sagt Anke Wollbrink. Sie lehrt als Professorin an der TU Darmstadt, ist Sachverständige für Nachhaltiges Bauen (SHB), BNB-Koordinatorin und leitet gemeinsam mit ihrem Partner Peter Schoblocher das Büro KONRAT, das Konzepte und Beratung für nachhaltige Architektur mit Standorten in München und Stuttgart anbietet. Außerdem ist sie als Referentin für die Koordination von Nachhaltigkeitszertifikaten in Architektur- und Bauingenieurbüros sehr gefragt. „Vor allem die unterschiedlichen Schwerpunkte der jeweiligen Anbieter sind eine gute Grundlage für Büros und Planerinnen, für sich zu entscheiden, mit welchem sie arbeiten und wie sie sich selbst auf dem Markt positionieren möchten.“
Dabei beginnt alles mit dem jeweiligen Auftraggeber: Je nachdem, ob es sich um private Bauherrn, nationale Unternehmen, die öffentliche Hand, ausländische Unternehmen oder international agierende Investoren handelt, bringen sie meist bereits eigene Anforderungen an den Zertifizierungsprozess mit.
„Private Häuslebauer sind in erster Linie daran interessiert, die staatlichen Auflagen zu erfüllen und sich für entsprechende Förderungen zu qualifizieren. Hier sind vor allem Energieberater gefragt, die nach dem System KfW-Effizienzhaus zertifizieren“, sagt Anke Wollbrink. Das sei zumeist eine Aufgabe für Externe, manche kleineren Büros sehen aber inzwischen auch eine Chance darin, ihre Beschäftigten entsprechend zu qualifizieren, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.
„Bei größeren Vorhaben, etwa im regionalen Wohnungs- und Kommunalbau, ist auch die Passivhaus-Zertifizierung noch relevant, da sie zur Betriebskostensenkung beiträgt und die Werthaltigkeit der Immobilie steigert.“ Zwar seien die Abstände zwischen den gesetzlichen Mindestanforderungen und High-End-Ausführungen in den vergangenen Jahren geschrumpft, aber in puncto Energieeffizienz gehört das Passivhaus-Zertifikat immer noch zum Goldstandard der Branche und liegt deutlich über den GEG-Anforderungen. Entsprechend bieten vor allem mittelgroße Büros eine entsprechende Zertifizierung auch inhouse an.
Vielfalt der Zertifikate
„Eine andere Sache sind die DGNB-Zertifikate und das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen des Bundes“, erklärt Anke Wollbrink. Während ersteres im privaten Sektor marktführend in Deutschland ist, ist letzteres sogar verpflichtend bei vielen Ausschreibungen des Bundes und auch bei zahlreichen Projekten auf Landesebene. „Wer als Büro in größeren Kategorien denkt und plant, kommt um beide nicht herum. Und es lohnt sich, entsprechende Kompetenzen im Büro selbst aufzubauen.“ Da die Grundlagen für eine spätere Zertifizierung bereits in der Leistungsphase 0 gelegt werden und sich die Anforderungen über ein breites Spektrum an ökologischen, ökonomischen, soziokulturellen, technischen und prozessualen Aspekten erstrecken, sei es sinnvoll, im Haus Koordinatorinnen zu benennen, die alle Aspekte während des Projektverlaufs im Blick behalten. „Das gibt natürlich auch jungen Architektinnen und Architekten die Chance, sich durch einen entsprechenden Schwerpunkt als wichtiges Bindeglied im Büro zu positionieren.“ Wer DGNB-Auditorinnen oder BNB-Koordinatorinnen beschäftigt, sichert sich bei vielen Ausschreibungen einen wichtigen Wettbewerbsvorteil.
Noch etwas spezieller – zumindest hierzulande – sind Zertifizierungen nach dem amerikanischen LEED- oder dem britischen BREEAM-Standard. Grob gesagt handelt es sich dabei um Zertifikate, die vor allem für international vermarktete und gehandelte Immobilien interessant sind. „Insgesamt sind die Kriterien für die Zertifizierung, verglichen mit hiesigen Angeboten, etwas weniger streng und transparent. Dafür haben sie jedoch im Ausland einen höheren Bekanntheitsgrad und werden seit ihrer Einführung vermehrt nachgefragt.“ Wer als Berufseinsteigerin oder Berufseinsteiger für weltweit agierende Büros arbeiten möchte, kann sich mit einer entsprechenden Qualifizierung ebenfalls am Markt sichtbar machen.
Assessor und Associate
Der Weg dorthin ist mit ein wenig Aufwand verbunden, aber überschaubar und mit ein paar hundert Dollar je Prüfung vergleichsweise günstig: Den Auftakt macht eine Prüfung zu allgemeinen Nachhaltigkeitsfragen, die online in einem Multiple-Choice-Test absolviert werden kann. Es winkt die Auszeichnung LEED Green Associate. Es folgt die Spezialisierung in einem Aufgabenfeld (z. B. Building Design and Construction oder Operations and Maintenance). Um im Anschluss eine Prüfung als LEED Accredited Professional ablegen zu können, ist zuvor eine Mitarbeit an einem LEED-Projekt innerhalb der vergangenen drei Jahre erforderlich. Nach erfolgreicher Akkreditierung müssen im Zweijahresturnus mindestens 30 Weiterbildungsstunden – mindestens sechs davon LEED-spezifisch – absolviert werden.
Die Ausbildung zum BREEAM Assessor übernimmt in Deutschland der TÜV SÜD. Wer zwei Jahre Berufserfahrung in den vergangenen fünf Jahren vorweisen kann, erhält für eine Teilnahmegebühr von derzeit 3 750 Euro einen Crashkurs über die Standards und darf sich nach bestandener Prüfung Assessor nennen. Prüfungs- und Lizenzgebühren kommen allerdings noch hinzu.
Auditoren und Koordinatoren
Etwas komplexer ist der Weg zum DGNB-Auditor: Zunächst muss man zwei bis drei Seminartage absolvieren, in denen man die Grundlagen des Systems, des Zertifizierungsprozesses und der zugrunde liegenden Standards kennenlernt. Diese Online- oder Präsenzseminare münden in eine schriftliche oder praktische Prüfung, nach der man sich DGNB-Consultant nennen darf. Für rund 1 000 Euro Investition darf man anschließend bereits Projekte begleiten und beraten. Um den Status zu halten, sind regelmäßige Weiterbildungen erforderlich. Für den Aufstieg zum Auditor sind etwa acht Wochen Lernzeit vorgesehen, wobei die ersten sieben Wochen als Selbstlernphase angelegt sind und in der achten Woche eine Präsenzprüfung stattfindet.
Zu den Inhalten gehören beispielsweise der Umgang mit der DGNB-Software, rechtliche Aspekte, Verantwortlichkeiten, Zusammenarbeit mit dem Projektteam, Erstellung von Pflichtenheften, Pre-Check und vieles mehr. Mitglieder zahlen dafür 1 690 Euro, Nichtmitglieder 2 090 Euro. Erfahrene Mitglieder können die Ausbildung ggf. verkürzt absolvieren und zahlen dann nur 790 bis 900 Euro. Als Auditorin oder Auditor erwirbt man das Recht, offizielle DGNB-Zertifikate auszustellen, muss jedoch unabhängig vom Projektteam arbeiten, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Auch hier sind regelmäßige Fortbildungen erforderlich, um den Status zu erhalten. Außerdem wird ein kostenpflichtiger Lizenzvertrag mit der DGNB geschlossen.
Angehende BNB-Koordinatorinnen und -Koordinatoren wiederum können sich aus dem Kursangebot der Kammern bedienen. Sie benötigen rund 80 Unterrichtseinheiten, um einen ganzheitlichen Überblick über das BNB-System zu erhalten, der die Kriterien, den Ablauf sowie Aspekte wie Ökologie, soziokulturelle Faktoren und Ökonomie umfasst. Auch EU-Taxonomie und der Vergleich zu anderen Systemen können Bestandteil sein. Die Kosten bleiben meist unter 2 000 Euro. Je nach Angebot kann – muss aber nicht – eine Prüfung Bestandteil der Kurse sein.
Vielfältige Perspektiven
„Grundsätzlich sind die Kammern und Berufsverbände immer eine gute Anlaufstelle, um sich tiefergehend über das Thema Zertifizierungen und Koordinierung zu informieren“, sagt Anke Wollbrink. Wer entsprechende Interessen verfolgt, tut zudem gut daran, in Mitarbeitergesprächen darauf hinzuweisen. Möglicherweise haben Vorgesetzte selbst schon darüber nachgedacht, eine Koordinatorin oder einen Koordinator im Büro zu etablieren. Dann ist vielleicht auch eine Ausbildung oder Schulung im Rahmen der Arbeitszeit möglich und muss nicht aus eigener Tasche gestemmt werden. Auch bei einem Arbeitsplatzwechsel kann eine entsprechende Qualifizierung hilfreich sein. „So oder so: Das Thema Zertifizierungen wird uns in Zukunft nicht mehr verlassen. Da ist es eigentlich für alle Planenden sinnvoll, zumindest Grundkenntnisse im Umgang damit zu erwerben.“⇥Jan Ahrenberg/DBZ
Adressen:
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)
www.dgnb.de/de/akademie
Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
www.bnb-nachhaltigesbauen.de/austausch/weitere-ansprechpartner/
BREEAM
www.breeam.de/ausbildung/
LEED
www.german-gba.org/en/leed-education-usgbc
Passivhaus Institut
www.cms.passivehouse.com/de/training/kurs-prufungsanbieter/weltweites-kurs-angebot/