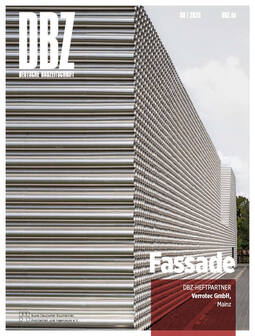Turbo im Leerlauf?
Wie schafft man per Gesetz möglichst schnell günstigen Wohnraum? Die aktulle Vorlage aus dem Bauministerium gibt dazu wenig Antworten – dafür erhalten die Kommunen jedoch mehr Spielraum für eigene Entscheidungen. Reicht das aus, um die Bautätigkeit signifikant zu erhöhen? Ein Gespräch mit Andrea Gebhard, Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, darüber, welcher Nachbesserungsbedarf aktuell noch besteht.
Liebe Frau Gebhard, wir führen dieses Gespräch Mitte Juli 2025, noch ist der § 246e, vulgo „Bau-Turbo“, ein Kabinettsbeschluss. Bis diese Ausgabe im September erscheint kann sich also noch das ein- oder andere ändern. Dennoch hätte ich gerne von Ihnen gewusst: Erkennen sie in dem jetzigen Beschluss den Bau-Beschleuniger, als den ihn Frau Ministerin Hubertz anpreist?
Das Bauen kann durch den sogenannten „Bau-Turbo“ tatsächlich beschleunigt werden und wir sehen auch positive Aspekte, wie die Erleichterung von Maßnahmen der Nachverdichtung etc. Vor allem die Lockerung des § 34, der das sogenannte Einfügungsgebot regelt. Es könnte also erleichtert werden, in bestehenden Gebieten geringer Dichte auch eine höhere Dichte zu realisieren. Gegenwärtig wird das durch das Einfügungsgebot erschwert.
„Auch positive Aspekte“ klingt allerdings so, als gäbe es auch Kritik…
Die gibt es durchaus. Was wir als problematisch ansehen ist, dass die Anwendung des § 246e nicht mehr auf Gebäude mit mehr als 6 Wohneinheiten beschränkt ist und nicht mit einem Baugebot verknüpft wurde. Durch ersteres droht die flächenintensive Ausbreitung von Einfamilienhausgebieten, ohne dass dabei genügend bezahlbare Wohnungen entstehen. Und ohne das Baugebot wird der Spekulation mit Bauland Tür und Tor geöffnet und es entstehen im schlimmsten Fall trotzdem keine Wohnungen.
Wie sieht Ihr Gegenvorschlag aus?
Wir würden uns mehr Effektivität in der Ausgestaltung des Gesetzes wünschen. Die Ressource Fläche ist nun mal begrenzt und wir müssen sie verantwortungsbewusst nutzen. Gerade haben wir eine Studie erstellen lassen, die aufzeigt, dass mit einer geringfügig höheren Dichte auch innerhalb des 30-ha-Ziels der Bundesregierung genügend Wohnungen geschaffen werden könnten.
Können Sie uns ein Ziel nennen?
Gegenwärtige Planungsrealität auf neu ausgewiesenen Flächen sind 24 Wohneinheiten pro Hektar. Das entspricht einem typischen Einfamilienhausgebiet. Im Geschosswohnungsbau kommt man ohne weiteres auf 60 bis 80 Wohneinheiten je Hektar und das ist noch lange keine hochverdichtete Großwohnsiedlung, sondern kann, eine gute Planung vorausgesetzt, ein sehr lebenswertes, ökologisches und soziales Quartier sein. Wir müssen also die vorhandenen Flächen viel effektiver nutzen und das bedeutet eben eine maßvolle Dichte. Diese garantiert den Bewohnern übrigens auch eine auch im Alter noch nutzbare soziale Infrastruktur. Schon jetzt kann in überalterten Einfamilienhaus-Gebieten die Versorgung zum Beispiel mit Pflegediensten der Menschen nicht mehr sichergestellt werden, da die Menschen zu weit gestreut leben.
Verkürzte Genehmigungsverfahren dürften zumindest bei Teilen Ihrer Mitglieder auf Zustimmung stoßen…
Teils, teils. Als Lösung wird hier die erleichterte Genehmigungsfreistellung präsentiert. Das heißt aber auch, dass Architektinnen und Architekten mehr Verantwortung übernehmen, was mit einem höheren Haftungsrisiko verbunden ist und entsprechend honoriert werden muss, da sich die öffentliche Hand immer weiter aus ihrer Verantwortung für die gebaute Umwelt zurückzieht. Was wir uns erhoffen, ist, dass wir die Baugenehmigungsbehörden personell und materiell verstärken, indem z. B. Architekten bzw. Ingenieurinnen die Sachverhalte prüfen und so zur Entlastung der Behörden beigetragen wird. Vor allem aber bedarf es hier der Digitalisierung der Prozesse. Nur so kann der Fachkräftemangel halbwegs ausgeglichen werden.
Hätten Sie mehr Mitspracherecht bekommen, wie hätten Sie den Paragraphen umformuliert, oder zumindest, welche Aspekte hätten Sie ergänzt?
Wir hätten den § 246e ehrlich gesagt am liebsten gar nicht eingeführt, weil wir glauben, dass er das bewährte Bauplanungsrecht aushebelt. Nun da er mal da ist, hätten wir, wie schon beschrieben, die Anwendung mit einem Baugebot verknüpft. Wir hätten weiterhin die Beschränkung auf Gebäude mit 6 WE und die Anwendung auf angespannte Wohnungsmärkte beibehalten. In der Fassung der alten Bundesregierung war dies noch der Fall. Die neue Bundesregierung hat diese sinnvollen Ansätze auch noch gestrichen. Ohnehin sind Bauprozesse ja nicht nur von den Genehmigungsverfahren abhängig. Auch die Preise belasten die Baukonjunktur. Hier wäre unser Vorschlag, die Kosten durch eine verringerte Mehrwertsteuer zu entlasten.
Frau Hubertz hat sich kürzlich mit der Auffassung zitieren lassen: Bürgerbeteiligung ja, „aber diese Dinge dürfen nicht bis Ultimo getrieben werden.“ Zwischen den kolportierten 5 Jahren für eine Baugenehmigung und den nun angestrebten 2 Monaten hätte es doch sicherlich noch Raum für ein Zeitziel gegeben, die – zugegebenermaßen oft zeitraubenden – Beteiligungsverfahren nicht mit der Stoppuhr durchführen zu müssen. Wie sehen die Position und die Vorschläge der BAK zu diesem Thema aus?
So unrecht hat Frau Hubertz hier nicht. Man kann es mit der Bürgerbeteiligung auch übertreiben. Zumal die, die sich beteiligen, nicht unbedingt für eine Mehrheit der Betroffenen sprechen. Aber: Es kommt eben darauf an, wie man diese Beteiligungsverfahren gestaltet. Gut gemacht, können sie auch Verfahren verkürzen, weil in der Ausführungsphase kein Widerstand mehr kommt, da alle Betroffenen bereits informiert, überzeugt und mitgenommen wurden. Ein realistische Zeitziel dafür könnte zum Beispiel ein Jahr, oder auch ein halbes Jahr sein. Um das zu erreichen wäre es aber nötig, die Genehmigungsbehörde zu entlasten. So könnte man zum Beispiel eine Vorprüfung durch andere Planungsbüros einführen. Das würde auch die antragstellenden Architektinnen und Architekten entlasten, weil sie nicht mehr riskieren würden, dass ein unter Hochdruck erstellter, möglicherweise mangelhafter Antrag von der Behörde abgeschmettert wird und sich damit das Zeitfenster für die Realisierung des Projekts schließt. Auch das ist ein Risiko der aktuellen Vorlage.
Aus Architekturbüros, die explizit auf nachhaltige und partizipative Strategien setzen, ist in der Regel zu hören: Der Planungsaufwand ist zunächst größer. Aber von Projekt zu Projekt wächst der Lernvorsprung, Prozesse beschleunigen sich und die Akzeptanz der Nutzerinnen und Nutzer steigt – und damit auch die Beständigkeit der Bauprojekte. Befürchten Sie, dass diese Mitglieder der BAK nun quasi um die Früchte ihrer Arbeit betrogen werden?
Es sind zunächst nicht nur die Nutzerinnen und Nutzer, sondern vor allem die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner eines neuen Vorhabens, die in einem Beteiligungsverfahren adressiert werden. Was sie sagen, ist aber grundsätzlich richtig. Wir haben keine Angst vor Mitsprache, aber man kann einen solchen Prozess gut und schlecht durchführen. Wenn es gelingt, die betroffenen Stakeholder zu überzeugen und mitzunehmen, ist der folgende Bauprozess definitiv einfacher. Es hängt eben sehr davon ab, wie man es macht. Das gilt übrigens auch für den Bau-Turbo. Und ich bin zuversichtlich, dass wir im Austausch mit dem Ministerium noch zu einem guten Ergebnis kommen werden, bis er dann hoffentlich im Herbst verabschiedet wird.
Ob so oder so, der „Bau-Turbo“ wird bald kommen – oder ist schon da. Was erwartet Planerinnen und Planer nun? Wie wird er ihre tägliche Arbeit beeinflussen?
Wir setzen uns als BAK dafür ein, dass sich gute qualitätsorientierte Verfahren etablieren, um Planerinnen und Planer einzubinden. Gefährlich wird es immer dann, wenn immer das billigste Projekt gewinnt. Das gilt jetzt schon und umso mehr, wenn wir nun auch mehr bauen. Den Fokus auf die Qualität vorausgesetzt, kann der Bau-Turbo natürlich auch eine Chance für Planerinnen und Planer sein, mehr Aufträge bringen und die Baubranche insgesamt beleben.
Man hat in der jetzigen Fassung ohnehin fast den Eindruck, es handelt sich um ein Gesetz aus dem Wirtschaftsministerium und nicht dem Bauministerium…
Warum auch nicht? Die Bauwirtschaft anzukurbeln ist in der jetzigen Situation bestimmt nicht schlecht. Es muss aber auf die richtige Weise geschehen. Die Bürger, das Klima und der Naturschutz im Allgemeinen dürfen dabei nicht auf der Strecke bleiben.
Die großen Lose werden sich ja vermutlich die großen Büros und GUs sichern. Kleinere Büros, ohne entsprechenden Umsatz und Referenzen, müssen dann auch noch fürchten, dass das knappe Personal, Kapital und Material von diesen Großprojekten aufgesogen wird. Welche Strategien empfehlen sie kleineren Büros, damit sie bei einem möglichen Wohnungsbau-Boom nicht leer ausgehen oder gar unter die Räder geraten?
Kleine Büros müssen sich gut aufstellen. Es wird nicht vermeidbar sein, dass auch kleine Büros sich stärker digitalisieren, sonst verlieren sie den Anschluss. Und sie müssen sich mit anderen vernetzen. Mit Fachplanern, Bauunternehmen, Baugenehmigungsbehörden und potenzielle Auftraggebenden. Viele tun das jetzt schon und wir möchten als Kammern dabei unterstützen. Einfach ist es tatsächlich nicht, die kleinen Büros wurden schon oft totgesagt, aber es gibt sie immer noch. Der entscheidende Vorteil kleiner Büros ist ihre Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit. Da sind die großen Büros eher schwerfällig. Diesen Vorteil müssen die kleinen Büros ausspielen.
Zum Abschluss noch die Frage: War es ein Fehler, den Gebäudetyp E nicht zum Bestandteil der Gesetzesinitiative zu machen? Als Signal und auch als wirtschaftlicher Anreiz, sich intensiver mit dem Thema Nachhaltigkeit beim sozialen Wohnungsbau auseinander zu setzen, ist der Gebäudetyp E doch schon gut etabliert.
Der Gebäudetyp E hat eine etwas andere Stoßrichtung. Beim „Bau-Turbo“ geht es um das Bauplanungsrecht. Also um Stadt- und Regionalplanung. Der Gebäudetyp E adressiert eher das Bauordnungsrecht und die sogenannten anerkannten Regeln der Technik. Hier haben wir zum Beispiel mit dem Hamburg-Standard auf Länderebene schon gute Ansätze, die in keiner Weise im Widerspruch zum Bau-Turbo stehen. Wir sind hierzu aber weiterhin im Gespräch mit der Politik, um den Gebäudetyp E weiter in die Praxis zu tragen.
Zum Beispiel, wenn es die von Ihnen eingebrachte Mehrwertsteuer-Erleichterung gerade auf diesen Gebäudetyp geben würde?
Wir haben den Begriff Gebäudetyp E selbst in die Diskussion eingebracht. Man muss sagen, dass der Begriff oft falsch verstanden wurde. Es geht nicht um einen klar definierten Gebäudtyp, sondern eher darum, dass Planende und Auftraggebende wieder leichter entscheiden können, z.B. von Baunormen abzuweichen. Eine Mehrwertsteuer-Erleichterung kann nur gewährt werden, wenn die Rahmenbedingungen klar definiert sind. Diese müssen so gesetzt werden, dass ein ressourcenschonender und nachhaltiger Wohnungsbau gestärkt wird.
⇥Interview: Jan Ahrenberg/DBZ