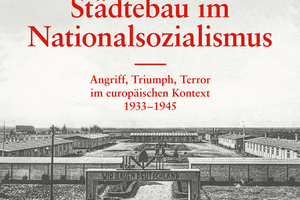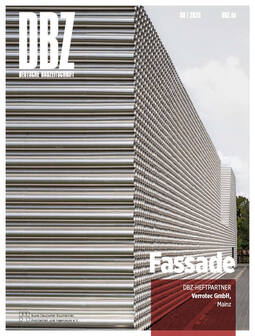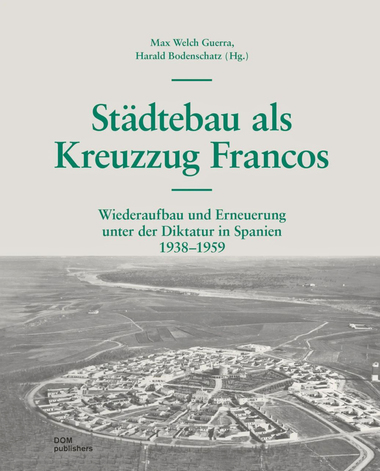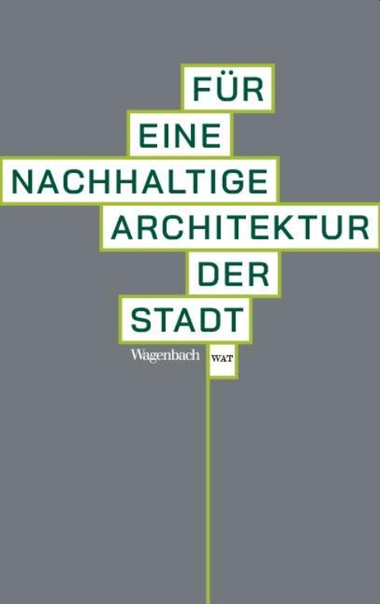Noch einmal von vorne
Ist eine umfangreiche, sehr ins Detail gehende Arbeit zum diktatorischen Städtebau im 20. Jahrhundert auch etwas für heutige Planerinnen? Was und wie planen wir anders, wenn wir über den Städtebau im nationalsozialisten Deutschland gelesen haben?
Oder sind Arbeiten wie die schwergewichtig vorliegende, die Teil einer wissenschaftlichen Publikationsreihe zum Themenbereich Städtebau und Diktatur ist – in der Sowjetunion, Italien, Portugal und Spanien –, nur etwas für Historiker, die möglicherweise andere Schlüsse ziehen, als ein Städteplaner in einer Verwaltung heute?
Dass vieles von dem, was die Nationalsozialisten damals städtebaulich dachten auch heute noch Antrieb von Städtebau ist, das kann man zwischen allen Zeilen lesen: Sicherung von Infrastruktur, Arbeitsplätzen und Wohnraum zur Wahrung des sozialen Friedens. Dass es vor bald 100 Jahren aber auch und gleichrangig um die Demonstration von Stärke ging, um ideologische Gleichschaltung durch die Inszenierung heroischer Baukunst, die 1 000-jähriges Bestehen versprach, ist ein anderes Thema; eines aber, das vielfach schon untersucht wurde.
Was also zeichnet diese Arbeit im Kern aus, deren Verfasser freimütig berichten, sie sei ohne die umfassende Arbeit der Kolleginnen aus den letzten Jahrzehnten in dieser Tiefe gar nicht möglich gewesen? Sie soll das Nationalsozialistische erstmals auch im Kontext anderer europäischer Diktaturen jener Zeit betrachten. Was vielleicht auch nicht neu ist, in der Gesamtschau über alles dann doch. Dass der Blick nach Italien oder Russland dann immer sehr knapp ausfällt, ist sicherlich dem Umfang der Arbeit geschuldet. Das Versprechen, eine integrale, eine übernationale Sichtweise zu üben, wird so aber nicht eingelöst.
Aber: Gerade wenn man einen Einstieg in das schier unübersichtliche Material der Forschung sucht, ist man hier richtig. Struktur und Themenfelder sind klar zueinander gestellt, die Chronologie orientiert die Leserinnenschaft, und manchmal ist man dann auch erstaunt, bestimmte Bilder, Nebenaspekte so noch nicht oder überhaupt noch nicht vor Augen gehabt zu haben. Andererseits ist gerade dieser Versuch, das Meiste zu zeigen, am Ende dann auch die Aufforderung, einem in Kürze präsentierten Aspekt eigene Forschung folgen zu lassen (wenigstens das Lesen in der angezeigten Literatur). Hauptaspekte sind dann Wohnungsbau, Altstadterneuerung, Innere Kolonisation, Bauten der Aufrüstung sowie die Anlage von großräumiger Infrastruktur, von Industriegebieten, Erziehungsanstalten und Lagern.
Die Arbeit endet mit einem Aufruf. Da dieser Band den Abschluss der Publikationsreihe zum Themenbereich Städtebau und Diktatur bildet, ist der Aufruf zur Europäisierung der Erinnerungs- und Bewältigungskultur ein Statement, das sich dem veränderten Wahrnehmen von Geschichte zur Seite stellt. Die Jungen, so die schon älteren Herausgeber, sehen anders auf Geschichte, entpolitisiert, detailgenauer und: Mit der Fähigkeit ausgestattet, „Legenden nüchtern zu zerlegen“. Damit sind wir alle – auch wir älteren – aufgefordert, das längst Gewusste noch einmal zu erfahren, beispielsweise in der Lektüre der Bände dieser großen und großartigen Reihe. Be. K.