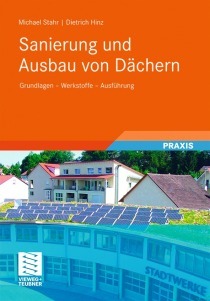Generationengespräch. Mit Sophie Merz und HG Merz, Berlin
Wie unterschiedlich schauen die Alten und Jungen auf das Bauen? Gibt es das für viele wesentliche Themen angenommene Generationen Gap auch in der planenden Zunft? Hier zu einer Erkenntnis zu gelangen interessiert Verleger ebenso wie die Verbände, Redakteure wie die Bauindustrie. Letztere beide – die DBZ Redaktion zusammen mit der Initiative Steildach „DACHKULT“ – luden nun Tochter und Vater, Sophie Merz und HG Merz, zu einem Gespräch ein. Das heisst, die Merzen luden uns zu sich ein, ins neue, jetzt gemeinsame Büro in Berlin-Charlottenburg.
Auf die Frage, wie es sich anfühlt, wieder unter einem Dach zu leben, antworten beide zögerlich, verhalten. Man lebe ja nicht gemeinsam unter einem Dach, eher sei es ja so, dass hier die Arbeit beide fast täglich zusammenbringt. Natürlich gebe es auch immer wieder familiäre Themen zwischen Tochter und Vater im gerade neu bezogenen Büro, aber das sei ja auch schön. Und teils auch anstrengend, so Sophie Merz. Die bisher getrennten Büros in Stuttgart und Berlin sind nun eins. In Berlin. Das gemeinsame Büro nennt sich „merz merz plus“. „plus“, weil es ja noch weitere KollegInnen, das ganze Team gibt.
Wir sitzen in der Bibliothek, oberhalb der Büroräume. Die schlichten Regale sind vollgestellt, „aber noch nicht richtig“, also eher bepackt. Erstmal. Mit Sophie Merz und HG Merz sitzen in diesem schönen Raum um einen großen Tisch noch Klaus H. Niemann, Sprecher der genannten Initiative Steildach, Tobias Nazemi, Geschäftsführer der Agentur Brandrevier, Katja Reich, Chefredakteurin DBZ und Benedikt Kraft, stellvertr. Chefredakteur DBZ.
Dass es an dem frühen Abend in der Merz’schen Bibliothek Anfang Juni auch um die Frage geht, ob denn die Tochter andere Vorstellungen, Wünsche, Vorlieben, Erfahrungen etc. mit Dächern – flach oder steil – habe als der Vater, war gesetzt. Doch drumherum und mittendrin ging es auch um andere Dinge; um das Kochen beispielsweise, wo im Raum man am liebsten schläft, ob Farben und welche richtig sind, was Heimat sei … Berlin? Lieber nicht!, so HG Merz, der nicht an einen Ort gebunden sein will. Berlin?! Auch wunderbar, so Sophie Merz, nicht zuletzt das die Haute Couture internationaler Architekten versammelnde Hansaviertel, in dem sie wohne.
Auf die Frage, ob denn nicht ein Neubau attraktiver gewesen wäre, sagt der Vater nein, die Tochter ja
Nach längerem Hin und Her zu Berliner Schnauze und Kiezen und dem Bekenntnis HG Merz, dass Berlin im Vergleich zu Wien null Charme habe, kommen wir auf den neuen Bürostandort, den die Tochter suchte und fand. Eine alte Remise oder die „Perle zwischen Schloss und See“, wie das Haus damals noch auf Airbnb annonciert war. Die Art und Weise des Umbaus haben sie beide besprochen, die ausführende Planung hat ein Kollege aus dem Büro übernommen … „Für sich selbst bauen ist doch das Schwierigste, das ich mir vorstellen kann!“ (Sophie Merz). Das Farbkonzept – u. a. Rosmaringrün, CI-Farbe des Büros – hat die Tochter allerdings in der Hand. „Nicht mein Thema“, so der Vater. Auf die Frage, ob denn nicht ein Neubau – wenn budgettechnisch möglich – attraktiver gewesen wäre, sagt der Vater nein, die Tochter ja. „Für sich selbst neu zu bauen bedeutet immer, es wird teuer“, so HG Merz. Ja, sie hätten sicherlich zusammen eine Form gefunden, auch wenn, wie Sophie Merz bedenkt, es beim Neubauen so viel mehr Möglichkeiten gibt. Auch Diskussionen!
Gibt es Ideologien, die trennen? Weniger Ideologisches, eher Standpunkte, die sich der Vater in seinem Berufsleben erarbeitete. Als gelernter Maurer sei ihm das schöne, materialgerechte Detail wichtig und er leide unter Handwerk, das vorgetäuscht ist. Die Tochter sieht das pragmatischer, zweifelt angesichts der allgemeinen Schnelllebigkeit am Sinn des Dauerhaften. Des Ewigen? Darüber nachdenkend schränkt HG Merz ein, dass ihm „nur“ Handwerk rückwärtsgewandt vorkomme, er arbeite sehr gerne mit Halbzeugen, wofür man allerdings eine breite Marktkenntnis brauche und eine Sprache, um mit der Industrie in einen effektiven Austausch zu kommen und Lösungen zu entwickeln. Beispielsweise bei der Opernsanierung in Berlin, den Arbeiten am Dach, die ohne die Industrie nicht machbar gewesen wären.
„Ein Entweder-Oder macht, wie in den meis-ten entwerferischen Belangen, keinen Sinn“
Und wo wir beim Dach sind, kommt das Stichwort Steildach wie von selbst. Ob es nicht Sicherheit in diesen unsicheren Zeiten vermittle, fragt Klaus H. Niemann. Das Steildach ist Teil des Archetypus Haus, jedes Kind zeichne ein spitzes Dach, so HG Merz. Und er plädiert für das Steildach, wenn es das Geschoss darunter erhöhe: „Obwohl ich selbst immer kleiner werde, brauche ich immer mehr Höhe über mir.“ Das steile Dach mit Volumenerhöhung verführe ihn zudem dazu, sein Bett mitten im Raum zu platzieren, direkt unter dem Dachfirst … Hier sei das Steildach klar im Vorteil.
Sophie Merz kann den Gedanken, dass ein steiles Dach Sicherheit, Geborgensein vermittle, nachvollziehen. Sie selbst hatte als Kind mit ihren Geschwis-tern die Zimmer im Dachgeschoss. Aber heute sei ein flaches Dach, das Möglichkeiten für eine Terrasse, einen kleinen Garten etc. biete, gerade in der Großstadt eine Option in der Planung. Und überhaupt solle man dem Dach jede Möglichkeiten geben. Zu diesem Haus passe ein steiles, zu jenem nur ein flaches. Ein Entweder-Oder mache, wie in den meisten entwerferischen Belangen, keinen Sinn.
„Da werden Häuser gewechselt wie hier die Kleidung“
Gibt es – mit dem hier angedeuteten Sehnsuchtsbild nach dem eher heimeligen Zuhause – tatsächlich aktuell eine Gegenbewegung zur Aufbruchstimmung der Moderne, die teils systemkritischen Charakter hatte mit durchaus auch ideologischem Potential? Klaus H. Niemann stellt die Frage in den Raum, wie Architektur auf die vielfältigen gesellschaftlichen Umbrüche reagieren könnte oder sollte? Das sei nicht so pauschal zu beantworten, so HG Merz. Mobiles Arbeiten beispielsweise könne den Trend zum verstärkten Zuhausesein unterstützen, gleichzeitig aber auch das Nomadenleben forcieren. Denn wenn Arbeiten von überall aus möglich wird, dann sollten wir auch das Wohnen vom Ort trennen. Wir sollten einmal in die USA schauen, „da werden Häuser gewechselt wie hier die Kleidung.“ Häuser wären dort nur noch Gefäße, die, innen von Einbauschränken gegliedert, jedem eine Heimat auf Zeit bieten. Allerdings sehe er auch, dass der Deutsche immer noch gerne zeigen wolle, was er kann und was er ist und darum wird sich das Häuserwechseln in diesen Breiten nicht so schnell einstellen.
Und fast schon am Ende des Gesprächs kommen Nachhaltigkeit und ein alter Porsche
Doch die Stile ändern sich, Dachlandschaften verändern sich. War, so HG Merz, bislang eine gewisse Expressivität gefragt, so haben mittlerweile Büros wie Herzog & de Meuron das Satteldach wieder möglich gemacht (die „Scheune“ auf dem Kulturforum). Wir unterhalten uns über Nachhaltigkeit und Exkursionen (auf denen die beiden eher nach kulinarischen Zielen Ausschau halten), über Baukultur und darüber, ob denn die Architektur der Moderne überhaupt noch die Sinne anspreche (unbedingt, so HG Merz mit dem Verweis auf den Niemeyer in Hansaviertel, in dem seine Tochter lebt). Es geht um die Lehre, den mangelhaften Diskurs und die große Bedeutung der wenigen Lehrer, „die mich mitgenommen haben“ (Sophie Merz). Und fast schon am Ende kommt die Nachhaltigkeit noch ins Gespräch und ein alter Porsche, der nachhaltiger sei als jeder auf Effizienz gezüchtete Neuwagen. Und dann noch das: „Ich wüsste nichts mit mir anzufangen, wenn ich kein Büro hätte, aber ich muss dennoch so langsam anfangen, dass ich da raus komme. Denn ich lese sehr gerne, höre gerne Musik, gehe ins Theater, alles Dinge, die mir umso wichtiger sind, weil ich sie mir permanent erarbeiten muss.“ Sophie Merz nickt zustimmend. Auf was genau sich dieses Zustimmen bezieht, muss offen bleiben. Wir sprechen weiter. Von draußen, durchs geöffnete Fenster, dringt immer wieder Vogelgezwitscher, Glockengeläut in der Ferne und lebhafte Kinderstimmen. Be. K.
Über Dachkult
Dachkult ist eine Plattform der Initiative Steildach, unterstützt von aktuell 22 führenden Herstellern der deutschen und internationalen Baustoffindus-trie und zwei Fördermitgliedern. Die Initiative will eingefahrene Vorstellungen und Klischees zum Steildach aufbrechen, die Begeisterung für das Steildach als faszinierendes Element der Baukultur neu entfachen und zum Perspektivwechsel anregen. Die Initiative richtet sich primär an Planer und Architekten, Bauträger und kommunale Bauabteilungen. www.dachkult.de