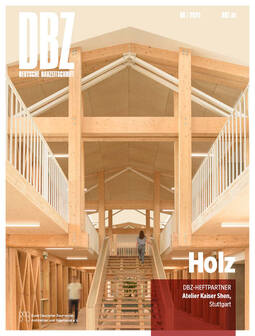19. Architekturbiennale Venedig
„Per aspera ad astra“, so schließt Carlo Ratti, der Kurator der 19. Architekturbiennale in Venedig, sein Vorwort im wie meist zweibändigen Ausstellungskatalog, in diesem Jahr unter dem Titel „Intelligens. Natural. Artificial. Collective. Biennale Architecttura 2025“. Um dann die schöne Seneca-Sentenz mit Bildungsbürgerpatina noch einmal und wirklich abzuschließen mit dem Satz: „And then back to earth.“ Womit er wohl andeuten möchte, dass die mühselige Arbeit, die Sterne (das Paradies?) zu erreichen, nicht das Eigentliche des Menschseins darstellt. Denn woran auch immer jeder Einzelne glaubt: Das Mutterschiff Erde und nicht die Sterne sind der Ort, an dem wir unser Leben mit allem auszuhalten haben; ein Leben zwischen Glück und Katastrophen.
 Hitzeschutz vom
Hitzeschutz vom
Einfachsten, gesehen in Venedig: Sonnen-/
Regenschirme
Foto: Benedikt Kraft
Von dieser Position ausgehend – dass wir uns nicht in Welten jenseits der Welt flüchten können und auch nicht sollten – skizziert der Architekt Carlo Ratti eine Bedrohungslage. Er spricht – wie eigentlich alle, die klar denken können – von „Handlungsdruck“: Die Erde brenne bereits. Nun brauchen wir alle Kraft, das Feuer klein zu halten und es vielleicht auch wieder zu löschen. Wen wir dazu brauchen: Alle. Oder wie man in der Werftenstadt Mestre sagt: Tutti le mane sul ponte! All hands on deck, oder eben: Intelligens im Kollektiven. Die einen brauchen wir, um die Perspektiven zu entwickeln, die anderen, um die Wege dahin zu bauen. Am Ende sind auch wir gefragt, die diese Wege mitgehen wollen. Doch in dieser großen, heterogenen Gruppe Engagement und Kollektiv herzustellen, das ist der große Haken an der schönen Sache. Vielen ist der Klimawandel immer noch und immer mehr Gotteswille oder immer noch nur ein wärmerer Sommer.
In Venedig, auf der Architekturbiennale, sollten die präsentieren, die die Perspektiven entwickeln und die Wege dahin bauen/planen/entwerfen. Das müssen nicht nur Architekten sein, in Venedig aber sind es diese. Dass sie immer weniger Gebautes zeigen in ihren Ausstellungsprojekten, wird von nicht allen verstanden. Man könnte aber sagen: Es gibt sie auch gar nicht, die eine gebaute Lösung! Mal sehen wir ein Foto, mal Diagramme, mal Räume, die, dezent gefüllt, eine Geschichte erzählen. Wer davon enttäuscht wird, sollte nicht gleich negativ die Leistungsschau resümieren, denn die Architekturbiennale ist ein Ort der Diskussion, der Weiterbildung. Man muss nicht alles gesehen haben (dafür bräuchte man vier volle Tage), man muss nicht alles verstanden haben. Es reicht, abends erschöpft, mit müden Augen und brennenden Fußsohlen vor der Bar am Kanal zu sitzen oder unter den Schirmen im Restaurant, und hier mit anderen über das alles zu sprechen. Tutti le mane sul ponte. Was aber nimmt man mit in die Abenddiskussionen und die – hoffentlich kontroversen – Gespräche zuhause?
 Es gibt auch Gebautes: The Porch, US-amerikanische Handreichung in Sachen Demokratie
Es gibt auch Gebautes: The Porch, US-amerikanische Handreichung in Sachen Demokratie
Foto: Benedikt Kraft
Ein Feuerlöscher als Heiligenfigur
Es gibt Glücksfälle, so den Pavillon der Spanier, der sehr aufgeräumt und klar designt vom Bauen im (neuen) Gleichgewicht erzählt, „Internalities“ heißt der Beitrag, der hinter die Äußerlichkeiten schauen möchte und dieses mit zig eingeladenen Beiträgen aus Spanien meistert. Es gibt den österreichischen Pavillon mit seinem Blick auf den Wohnungsbau in Wien und Rom. Mit der „Agency for Better Living“ vergleichen die Kuratoren die Wohnungsbaustrategien von Wien und Rom und kommen zu klaren Schlüssen.
Die Polen agieren mit Witz und Knappheit. Ihr „Lares and Penates: On Building Sense of Security in Architecture“ nähert sich dem Ursächlichen des Bauens durchaus ironisch an. Die zur Skulptur zusammengeschweißten Fenstergitter, das auf die Wand gesetzte Vordach über einer Tür, die es nicht gibt, das mit Fellstoff gekennzeichnete Gesichtsfeld der Überwachungskamera, ein wie eine Heiligenstatue platzierter Feuerlöscher und vieles andere.
 Wärmebild über Realbild
Wärmebild über Realbild
geblendet: die Hitzestadt Athen im Filmstil (Deutscher Pavillon)
Foto: Benedikt Kraft
Ägypten lädt zum Mitmachen an einer gigantischen Wippe ein, die es im Idealfall ins schwebende Gleichgewicht zu bringen gilt. Die Briten sind british distinguished mit ihren Skulpturen. Die Franzosen müssen, weil ihr Pavillon saniert wird, in den Raum davor und drumherum ausweichen. Ihre Ausstellung, die städtebauliche Projekte zeigt, könnte Teil einer Wanderausstellung werden. Geschlossen ist der Pavillon Israels, während in seiner Nachbarschaft die USA ihrem Pavillon ein hölzernes Vordach („Porch“) gegeben haben, ein Brise Soleil, der Menschen zum Miteinander einlädt. Drinnen liest man vom demokratischen Selbstverständnis der US-amerikanischen Gesellschaft, was an deren aktuellen Präsidenten denken lässt, der das Demokratische abzuschaffen anstrebt: „[...] This quintessentially American constructed Place is at once social, […] generous, democratic.”
Die Skandinavier: Skandinavisch klar und gradlinig, die weite Fläche erlaubt das Ambulare im Raum, etwas, das in den Arsenale nebenan absolut unmöglich ist. Wohl weil der zentrale Pavillon in den Giardini wegen Sanierung und Umbaus geschlossen ist, musste Carlo Ratti „seine“ Ausstellung auch dort unterbringen, was dem Ganzen nicht guttut: Reizüberflutung.
Der deutsche Beitrag irgendwie dazwischen
Reizüberflutung gibt es im deutschen Pavillon auch, aber nur kurz, wenn sich der Film im Hauptraum zu ballen scheint in Bildern, Thermografien und Straßen-, Baustellen- oder Sprechgeräuschen, die aus extrem verdichteten, überlagerten Nachrichtenschnipseln und aus dem Reportervokabular zur Klimakrise erzeugt werden. Doch vor dem Film hat uns das dunkle Läuten einer digitalen Glocke in den Pavillon gerufen. Wir sehen/hören den Glockenklang, eine fremde Stimme in den Giardini, schauen in die Glocke, in welcher der Klöppel schwingt und uns ruft. Zum Gebet? Zur letzten Runde? Wird ein- oder ausgeläutet und wenn ja, was? Nicht lange gezögert, hinein und die Wand mit Glockenfilm umrundend landen wir im Hauptraum, auf dessen Wänden der genannte Film in Endlosschleife läuft und sehr eindrücklich von zu hohen Temperaturen in unseren Städten, von zu viel, zu wenig Wasser, von der Hitze auf den Plätzen und den Hitzetoten erzählt. Schließlich die wunderbare, ikonische Stimme der Maria Callas, deren alle 15 Minuten gespielte Arie „Casta Diva“ aus Bellinis „Norma“ ein Ohrwurm ist, zu Recht! (Ich frage mich allerdings, was das „spargi in terra quella pace“, was der Friedenswunsch im Lied mit Hitze zu tun hat!)
Rechts geht es aus dem Bilderraum mit großer suggestiver Wirkung in den Stressraum (rechts, mit Heizgerätschaften und Wärmebildern vom eigenen, sich im Raum bewegenden Körper), links in den Entspannungs- oder „Destress-Room“ mit ein paar grünen Gartenstühlen aus Aluminium und ein paar Pflanzkörben, in denen raumhohe Bäumchen stehen, die Kühle spenden (sollen). Von diesen beiden Räumen gelangt man dann in die letzten Nebenräume zu Zahlen, Fakten, Diagrammen im Raum und auf den Wänden, die das Thema Hitzestress anschaulich machen.
Doch zuerst spielen die Kuratorinnen des deutschen Pavillons, das Team STRESSTEST, sehr bewusst mit dem Immersiven. Das Team will uns emotional erreichen, um das auch sehr technische, soziale, politisch ökonomisch zentrale Ereignis – den Klimawandel – näher rücken zu lassen; man könnte schreiben: auf die Pelle rücken zu lassen! Das ist nicht angenehm, doch unangenehm soll es auch nicht werden, der erhobende Zeigefinger wird vermieden. Die meisten Besucherinnen schauen sich den Film an oder fragen sich im Hitzeraum, ob es unter dem eigenen Dach im Sommer im Schlafzimmer nicht noch unerträglicher ist, oder ob die Pflanzen im Destress-Room nicht deutlich zu wenig Erde an den Wurzeln haben, um mehr zu sein, als Klimaregulatoren für ein halbes Jahr in einem Pavillon.
 „Let me warm you“, eine Abrechnung mit dem Dämmwahn usw. Estland
„Let me warm you“, eine Abrechnung mit dem Dämmwahn usw. Estland
Foto: Benedikt Kraft
Zu voll, zu viel bling bling, eine Überforderung für unsere Sinne. Goldener Löwe
Der deutsche Beitrag ist nicht der einzige, der sich der Überhitzung und seinen Folgen widmet. Hitze spielt bei vielen Arbeiten eine Rolle. So auch bei „Heatwave“, einer Arbeit des Königreichs Bahrain, die den Goldenen Löwen für den besten Nationenbeitrag erhielt. Oder die Installation gleich zu Beginn der Corderie in den Arsenale mit dem schönen Titel „The third Paradise Perspective“ (Fondazione Pistoletto Cittadelarte), die ebenso auf das Immersive, das körpernahe Erleben setzt. So erzeugen banale Klimageräte – die wir auf Gebäudeaußenwänden wie auch die Satellitenschüsseln schon längst als selbstverständlich wahrnehmen – mit ihrer Abwärme im Zusammenhang mit den darunterstehenden Wasserbassins eine drückende Schwüle in dem nachtschwarzen Raum, eine Bedrückung, die in der Realität des millionenfachen Gebrauchs nichts anderes ist, als schlicht zusätzliche Wärme in den Straßen. Zu denen sind die Energiefresser hin ausgerichtet, um die Innenräume ungesund kalt zu machen. Dabei produzieren sie jede Menge CO2, das wiederum die Durchschnittstemperaturen anhebt, worauf die Anlagen noch einmal stärker arbeiten müssen etc. Dass hier auch Transsolar dem Klimagerät eine Arbeit widmet freut – künstlerische Gestaltung und wissenschaftliches Differenzieren treffen sich im Dialog.
Was danach in der Corderie und weiter folgt, ist eine Überforderung derjenigen, die sich einen Tag für diesen Teil der Ausstellung vorgenommen haben. Dicht gepackt stehen Arbeiten neben- und fast schon ineinanderverkeilt, überall blinken und winken die Monitore, öffnen und schließen sich Strukturen, die entweder Monitore beinhalten oder große Kissen, von denen aus wir erschöpft liegend auf Monitore schauen können, auf denen Monitore Botschaften senden usw. Ein paar Architekturmodelle, ein paar Fotografien, ein paar Diagramme und Grafiken … Und dann – dicht umlagert und staunend diskutiert und fotografiert – das Künstliche. Also die Intelligens des Künstlichen oder die AI. Anschaulich und zugleich sehr banal dargestellt mit Hilfe von robotischen Humanoiden, die sich bewegen, sprechen und blinken (ist deren CO2-Foodprint/Kreislauffähigkeit eigentlich schon berechnet?).
Es gäbe noch so viel. Eine Arbeit von Philippe Starck, „A House for the Price of a Car“, die „Fratelli“ von Matteo Thun & Partners oder, ganz im Kontrast, aber nahe bei, eine Hütte aus Flechtwerk, aus der weinende Kinder zu hören sind. Oder das spektakuläre „Deserta Ecofolie: A Prototype for Minimum Dwelling in the Atacama Desert and Beyond“ von Pedro Ignacio Alonso und Pamela Prado, das zwar schön anzuschauen, aber wie Fosters entworfenes „Gateway To Venice’s Waterways“ zu sehr gebautes Design ist; das Erinnerungen weckt, aber keinerlei gangbare Wege in die Zukunft aufzeigt.
„I no longer have anything new to say to you. But one more thing: No is more.”
Es gibt viele Beiträge zu (meist alten) Materialien, elegante und teils erstaunlich hochwertige Ins-tallationen und sichtbar mehr Kollaborationen als in der Vergangenheit. Man kann, wenn Zeit ist, Manifeste lesen, so wie das von Márton Pintér, Kurator des ungarischen Pavillons, der unter dem Titel „There Is Nothing to See Here“ eine Menge zum Selbstverständnis der Architektenschaft aufdeckt. Unter „One Place, one Solution. A new Mindset“ formuliert Márton: […] „You should no longer design houses. You should no longer anything new to say. I no longer have anything new to say to you. But one more thing: No is more.“ Materialien werden präsentiert in fremden Kontexten, Fotografien, die anrühren und begeistern, es gibt jede Menge Gedrucktes und niemand wird es alles lesen können. Die AI vielleicht? Die ganz sicher, aber dieses Lesen ist selbstbezüglich und sinnlos. Man wird hinfahren müssen mit Zeit im Gepäck. Vielleicht den dicken Katalog schon mal durchgeblättert und mit denen gesprochen haben, die schon dort waren.
Am Ende gibt es immer noch die Stadt. Die selbst gerade mit der Zukunft hadert und sehr viel lernt und ausprobiert, auch das Falsche. Aber wenn man etwas daraus lernte, wäre es wieder optimal!
Benedikt Kraft/DBZ
www.labiennale.org