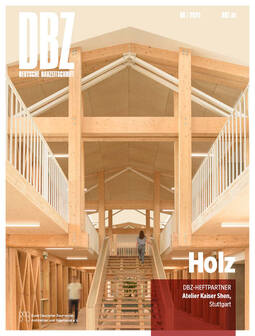Robin Hood Gardens ist Geschichte. Erinnern wir uns?
Abriss ist überall. Nun wurde im Londoner Osten der zweite Riegel von Robin Hood Gardens abgerissen, das Material entsorgt. Was mit den Mieterinnen des brutalistischen Sozialwohnungsbaus wird? Sie dürfen umziehen, wenn sie die Neubaumieten zahlen können und sich auf eine ganz andere Nachbarschaft einstellen.
Habe ich etwas überhört, überlesen? Gab es einen letzten Aufschrei in der deutschen (Fach-)Presse oder sind die Antennen gerade anderen Regionen zugewandt als dem Osten Londons, wo nun gerade die letzten Trümmer von Robin Hood Gardens abgeräumt werden? Ganz anders 2017, als sich viele Kolleginnen vor die Tastatur ihrer Textgeneratoren setzten und schrieben. Gegen den Abriss einer Wohnsiedlung, deren Planung aus den 1950er-Jahren stammte, die aber erst Anfang der 1970er-Jahre fertiggestellt war. 213 Wohnungen, in nächster Nähe zum immer noch expandierenden Büro-Distrikt Canary Wharf, Luftlinie 4,75 km von der Tower Bridge entfernt, für Londoner Verhältnisse also mittendrin. Als dann noch ein Stückchen Originalfassadenkonstruktion des ersten Abrisses vom Victoria & Albert Museum erworben und anlässlich der Architekturbiennale 2018 auf dem Arsenalegelände ausgestellt wurde, da gab es fast hymnische Rückblicke auf das früh/späte Werk der Smithsons.
Aggressive Bewohnerinnen
Als Sozialer Wohnungsbau von Alison und Peter Smithson entworfen, war die zweiteilige Anlage um den begrünten Schutthügel der hier vorher stehenden Wohnungen der Grosvenor Buildings eine deutliche Referenz auf Le Corbusiers Wohnmaschinen, seine „Unité d‘habitation“, die bekannteste in Marseille, 1952 fertiggestellt. Die Grosvenor Buildings waren ebenfalls Sozialwohnungen, die ebenfalls aus vielleicht ähnlichen Gründen scheiterten: Überbelegung, schlechte Pflege, Erschließungsmängel und Mangel an sicheren, informellen Orten. Und: Ganz anders als bei der Unité in Marseille beispielsweise, war der Standort denkbar schlecht; was vielleicht gewollt war. In jedem Fall wollte in diesem vom Verkehr dominierten Bezirk niemand sonst Geld in Wohnungsbauarchitektur investieren.
Peter Smithson gab in einem späten Interview zu Protokoll, die von ihm und seiner Partnerin geplante Anlage hätte von ihren Bewohnerinnen nicht angenommen werden können, denn wichtige, auch notwendige Individualisierungsansätze wie unterschiedlich farbige Eingangstüren, Möbel auf den „Straßen im Himmel“ – die alle drei Geschosse eingefügten horizontalen Erschließungskorridore – oder Pflanzen wären sofort beschädigt, zweckentfremdet oder gestohlen worden. Der Grund für derart aggressives Verhalten ist den Kritikern von Massenwohnungsbauten dieser Art klar: die Enge, Beschäftigungslosigkeit, Perspektivlosigkeit etc. sowie der voranschreitende triste Gesamtzustand der Anlage und das homogene soziale Millieu hätten einfach ihre Wirkung und müssten als direkte Reaktion auf den Brutalismus interpretiert werden, dem man in Robin Hood Gardens ausgesetzt sei.
Warum der Niedergang?
Dass das, bezogen auf den Zustand des hier besprochenen Gebäudes, mit ein Grund für sein Scheitern ist, kann angenommen werden. Die oben schon als für Wohnen ungeeignet eingeschätzte Lage ein weiterer. Doch es gibt andere Großanlagen, die gut funktionieren, in denen das Nachbarschaftliche wesentlicher ist als in Gründerzeitenviertel und schon gar in den hochpreisigen Park Estates mit Stadtvillenhäufung, wo sich jeder selbst genug (Familie) ist. Warum also der Niedergang?
Ein Grund für erste Abrissüberlegungen aus den frühen 2010er-Jahren ist der Bodenpreis, der – angesichts der heranwachsenden Canary Wharf, steigende Bodenpreise und maroden Bestandzustands – die Stadt London zum Handeln lockte. Und vielleicht auch drängte, denn die dringend anstehende und bereits Bautensicherheit herzustellende Sanierung der beiden, 7- und 10-geschossigen, sich um den Robin Hood Garden schließenden Hochhausscheiben, wäre über die deutlich unter dem Durchschnitt des Bezirks liegenden Mieten nicht zu finanzieren gewesen. Die aktuelle Planung sieht so eine deutlich höhere Dichte in der Bebauung vor, rund 1 700 neue Wohnungen sollen hier und auf anliegenden Parzellen auf einer insgesamt 2 ha großen Fläche realisiert werden, dazu kommen Büroflächen, Schulen, lokale Versorger etc.
Die Smithsons adeln alle Architektur
Robin Hood Gardens wären vielleicht nicht so sehr im Fokus, wären die beiden Wohnhochhausscheiben nicht das Produkt des Architektenpaars Großbritanniens. Zwar nicht unter Denkmalschutz – ganz im Gegenteil vor dem Denkmalschutz geschützt! – stand das Ensemble für einen wesentlichen Ausschnitt europäischer, vielleicht gar weltweit gültiger Architekturgeschichte.
Doch: Was interessiert die Ökonomie die Geschichte von Gestern, wenn man mit der Zukunft in Zukunft besser, leichter (?) Geld verdienen kann? Dieser Standpunkt ist akzeptabel, wäre da nicht gleichzeitig das Schweigen all derer, die hier später teure Wohnungen beziehen, das Schweigen derer, die sich nun anderen Baustellen zuwenden, das Schweigen der Stadtmütter, die Prosperität über soziale Gerechtigkeit stellen. Aber vielleicht hängt das eine am anderen und beide zusammen sind die Lösung!?
⇥Benedikt Kraft/DBZ