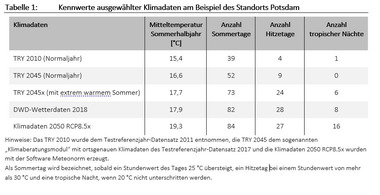Grüne Wiese, Konversion,
Nachverdichtung
Überschwemmungen, Hagel, Dürren, Hitzewellen oder Smog – die Auswirkungen des Klimawandels sind längst spürbare und sichtbare Realität. Besonders in dichten Ballungszentren wie Städten und Metropolen stehen Gesundheit, Aufenthaltsqualität und damit das gesellschaftliche Zusammenleben zunehmend unter Druck. Gleichzeitig leben weltweit, auch in Deutschland, immer mehr Menschen in Städten. Durch die Urbanisierung wächst nicht nur die dortige Bevölkerungszahl, sondern auch der Flächenverbrauch und der Versiegelungsgrad. Gleichzeitig dominiert der Individualverkehr. Eine fehlende Abkehr vom Auto in Kombination mit wachsendem Wohnraummangel und einem steigenden Pro-Kopf-Flächenbedarf führt zu einem gefährlichen Ungleichgewicht. Metropolregionen geraten dadurch unter enormen Flächendruck. Boden und Raum werden Mangelware und somit zur Spekulationsware. Klimawandel, Migration, Globalisierung, aber auch Privatisierung, Spekulation und Gier verschärfen diese Dynamik zusätzlich.
Drei grundlegende Raumstrategien prägen derzeit den Umgang mit dem wachsenden Raumbedarf, Flächendruck und der Wohnraumkrise: die Bebauung unversiegelter Flächen (Bauen auf der „grünen Wiese“), Konversion bestehender Areale und die Nachverdichtung und Weiterentwicklung des Bestands. Trotz unterschiedlicher ökologischer und gesellschaftlicher Ansätze können diese drei Strategien auch kombiniert werden und sich sinnvoll ergänzen. Welche dieser Raumstrategien ist am zukunftsfähigsten? Sollten bestimmte Strategien im Kontext des Klimawandels und gesellschaftlicher Identitätskrisen stärker priorisiert und andere hingegen kritisch hinterfragt werden? In diesem Heft werden drei Schlüsselprojekte vorgestellt, die jeweils beispielhaft für eine der genannten Raumstrategien stehen. Sie veranschaulichen, welche Potenziale und Herausforderungen mit den unterschiedlichen Herangehensweisen verbunden sind. Diese Ausgabe soll dabei wichtige Anknüpfungspunkte für die notwendige Diskussion um eine nachhaltige und resiliente Stadtentwicklung liefern. Diese Debatte sollte nicht erst auf Gebäudeebene geführt werden, sondern bereits bei der Planung neuer Stadtquartiere im übergeordneten Maßstab beginnen.
Wir bei Octagon Architekturkollektiv denken und arbeiten bewusst in unterschiedlichen Maßstäben, wobei der Fokus besonders auf der stadträumlichen Ebene liegt. Unsere Arbeiten bewegen sich im Spannungsfeld zwischen räumlicher Gestaltung und gesellschaftlichen Fragestellungen. In den Arbeitsfeldern Städtebau, Architektur und Landschaftsarchitektur entwickeln wir Strategien und Gestaltungsideen für das gesellschaftliche Zusammenleben. Dabei sind wir uns des hohen ökologischen Fußabdrucks der Baubranche bewusst und hadern stetig mit dieser Verantwortung. Unsere Haltung ist, möglichst nachhaltig und ressourcenschonend zu planen und zu bauen. Wir nehmen dies als großen Widerspruch wahr, denn jeder Quadratmeter bebaute Fläche bedeutet Material- und Ressourcenverbrauch. Daher suchen wir kontinuierlich nach einer vertretbaren Haltung und planerischen Antworten.
Als Stadtplaner:innen setzen wir uns für einen nachhaltigen Umgang mit Flächenressourcen ein. Der Fokus liegt hierbei auf einem möglichst geringen Flächenverbrauch, dem Erhalt von Grünstrukturen sowie dem konsequenten Rückbau der autogerechten Stadt. Als Architekt:innen setzen wir auf ökologische Baustoffe und denken Materialkreisläufe mit. Als Landschafts-architekt:innen setzen wir auf eine klimaresiliente Stadtentwicklung, die die Biodiversität fördert.
Unsere Überzeugung ist klar: Eine zukunftsfähige Stadtentwicklung nutzt vorhandene Ressourcen. Daher haben wir für uns entschieden, dass wir keine Projekte mehr auf der „grünen Wiese“ realisieren wollen. Entsprechende Vorhaben schließen wir konsequent aus unserer Akquise aus. Diese Entscheidung basiert auf zwei wesentlichen Gründen: Einerseits ist die Inanspruchnahme unversiegelter Flächen ökologisch nicht vertretbar, denn im Bestand befinden sich zahlreiche Raumpotenziale. Durch den gesellschaftlichen Wandel werden sogar stetig fortlaufend Bestandsstrukturen obsolet und es entstehen neue Frei- und Möglichkeitsräume.
Andererseits und ganz entscheidend ist aber auch die Geschichte und Identität, die der Bestand mitbringt. Damit trägt er dazu bei, dass Quartiere, Gebäude und öffentliche Räume Ausstrahlung haben, Geschichten erzählen und damit Räume erst lebendig machen. Dieser Aspekt sollte gerade im Kontext von Identitätsfragen unserer Gesellschaft nicht unterschätzt werden. Unsere gebaute Umwelt gibt uns Halt – und fordert uns heraus.