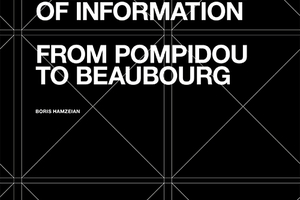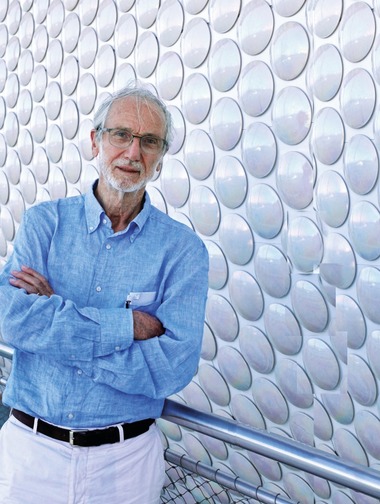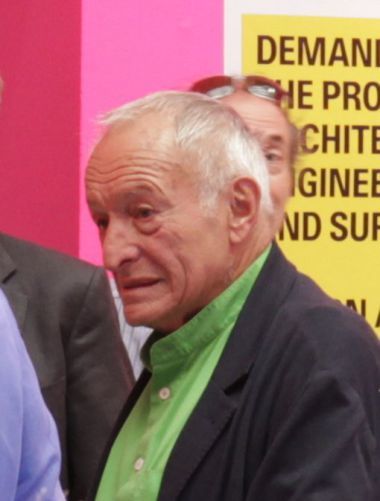Detektivisch und wunderbar
Als im November 2008 in Berlin ein Bundesbauminister mit einem Juryvorsitzenden einen Pappkarton in die Höhe zog und unter diesem Karton das Modell des Gewinners zu sehen war (der Schlossneubau von Franco Stella), war den Letzten klar – so auch dem Autoren dieses Stücks –, dass aus der Hoffnung auf ein Centre Pompidou für Berlin nichts geworden war. Berlin hatte – die Vorgeschichte wollte auch gar nichts anderes zulassen, außer Ungehorsam – Vergangenheit gewählt, Preußens Glanz und Gloria.
1971, also 37 Jahre zuvor, gewannen Renzo Piano, Richard Rogers und Gianfranco Franchini (mit Ove Arup) als absolute Außenseiter den international ausgelobten, prestigeträchtigen Realisierungswettbewerb für das Centre Beaubourg im Herzen von Paris. Ein Meteor, schmerzender Fremdkörper, ein „metallischer Staudamm“, wie ihn die Presse missverstand. Ein Jahrhundertprojekt, weit jenseits dessen, was die deutsche Bundeshauptstadt mit steinerner Traufhöhenvorgabe sich jemals hätte erlauben wollen. Aber ist die Schöpfung des wirklichen und weltweit einmaligen Aliens tatsächlich eine geniale?
Als Jean Prouvé und Robert Bordaz am 19. Juli 1971 den siegreichen Wettbewerbsentwurf präsentierten, gab es keinen Applaus. Die wenigsten Befürworter kamen aus Paris selbst, wenn überhaupt wurde der Entwurf von weit außerhalb Frankreichs beklatscht; die Jury, der u. a. Jean Prouvé, Oscar Niemeyer und Willem Sandberg angehörten, soll von dem charismatischen Philip Johnson dominiert worden sein; und der Initiator des Wettbewerbs, Frankreichs Präsident Georges Pompidou, wurde angeblich gezwungen, einen Sieger zu akzeptieren, den er nicht unterstützte.
50 Jahre nach diesen Ereignissen ist es an der Zeit, mit Hilfe aller verfügbaren Dokumentarquellen und Dutzender Zeugnisse diese Gewissheiten zu analysieren und die Genealogie dieses noch immer umstrittenen Werks nachzuzeichnen: von Pompidous ursprünglicher Idee eines Monuments zur Belebung der französischen Architektur im internationalen Diskurs über die komplexen Ursprünge eines Projekts, in dem die Ambitionen und avantgardistischen Impulse von Architekten und Ingenieuren fein austariert koexistierten, bis hin zur Rekonstruktion der komplizierten politischen Intrigen und ideologischen Visionen, die sich hinter den Beratungen der Jury verbergen; oder muss ich schreiben: verbargen?
Denn zweierlei macht die Publikation wertvoll. Zum ersten ist es die akribische Forschung zum Werden des großartigen, ikonischen und wie nur wenige andere Architekturen wirksamen Projekts im Herzen der Seine-Metropole. Sogar frühe Entwurfs-Skizzen, deren zig-facher Abdruck wie selbstverständlich erscheint, sind hier mit „erstmalig abgedruckt“ gekennzeichnet.
Beinahe wesentlicher als die detektivische Fleißarbeit in den Quellen aber erscheint, dass mit einem Mal das Singuläre des heute immer noch Singulären Nachbarschaft erhält. Boris Hamzeian haben wir es zu verdanken, den schließlich realisierten, immer noch spektakulär mutigen Entwurf neben anderen zu sehen, die teils nicht minder von großartigem Wurf zeugen. Ähnliche Strukturen offenliegender Tragwerke, tief in den Boden oder weit über ihn gestellte Tempelanlagen der Kunst und der Bildung deuten auf eine Zeit, in der obzessives Träumen noch möglich war, in der Gestaltung mehr war als reine Form oder kunsthistorische Referenz. Die 1960er-Jahre waren voller Ressentiments und (daraus resulierenden) Dynamiken zugleich. Reibungshitze erzeugte das kulturelle Unbändigseinwollen. Der Westen baute seine Vormachtstellung auf der Welt aus, als gehöre sie ihm. Die Architektur probierte aus, was noch nie zuvor ausprobiert war: Zum Beispiel eine aufblasbare Megastruktur, erfunden in Deutschland vom Strukturalisten Manfred Schiedhelm: einziger deutscher Beitrag in diesem internationalen Wettbewerb mit Auszeichnung. Seine TU-Bauten in Berlin stellten für das Gewinnerteam eine frühe Inspiration dar.
Derart kontextualisiert kann man sich kaum vorstellen, auf dem Gelände der abgerissenen Hallen – dem Bau von Paris – etwas anderse zu sehen als eben das, was da ist: eine einmalige und immer noch sehr lebendige Historizität, eine scheinbare Widersprüchlichkeit, die 2023 in dem hier abgedruckten Interview einer der Architekten, Renzo Piano, so kommentiert: „Das Wesen von Beaubourg ist doch, dass es im Zeitenlauf so viel auszuhalten in der Lage ist. Dabei ist es wie ein Pferd, das seinen Reiter leicht trägt, ihn aber ebenso leicht abwerfen kann, wenn sein Gewicht stört.“ Dem Buch liegt eine faksimilierte Zeichnung bei, ein Längsschnitt durch das Centre aus der Wettbewerbsphase auf dessen Gegenseite alle Teilnehmerteams gelistet sind. Be. K.
Boris Hamzeian, The Live Centre of Information. From Pompidou to Beaubourg (1968–1971). Actar, New York/Barcelona 2022, 336 S, ca. 300 Farbabb.
40 €, ISBN 978-1-63840-055-4