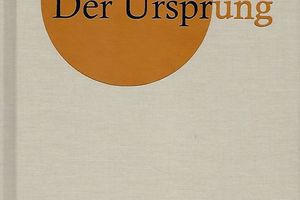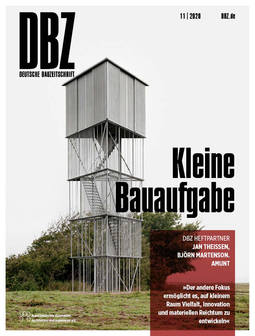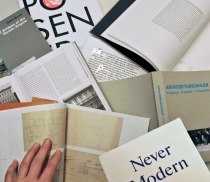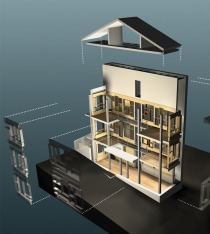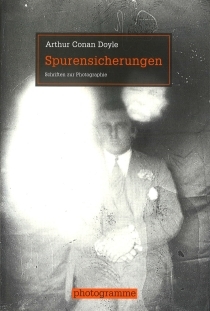Populärliteratur
Also gut. „The Fontainhead“ oder „Der Quell“ oder „Der Ursprung“, wie er aktuell in seiner dritten Übersetzung ins Deutsche vorliegt, soll nach der Bibel in den bigotten USA eines der meistgelesenen, in jedem Fall politisch höchst einflussreichen Bücher sein. So jedenfalls wurde der Roman denjenigen ankündigt, die im September ins ostwestfälische Marta gekommen waren, um Gudrun Landgrebes Lesung aus diesem Roman zu lauschen. Der Grund für die Auswahl des Lesestücks bleibt verborgen. Gegen eine Neulektüre des gut 1 000 Seiten umfassenden Buchs spricht so einiges, nicht zuletzt der Verlag und der Übersetzer, die beide in der eher rechtskonservativen Szene zu verorten sind. Bücher zum Thema, warum der menschengemachte Klimawandel eine Erfindung des linksliberalen politischen Establishments sind, machen den Hauptanteil der Publikationen des TvR Medienverlags aus. Womit wir wieder bei der Bibel wären, in der auch viele Geschichten erzählt werden, die nicht bloß, aber vor allem in den USA gern für bare und insbesondere nicht konvertierbare Münze genommen werden. In der aktuellen Übersetzung – warum diese gemacht wurde nach den zwei schon vorliegenden, erklärt der Verlag nicht – des Romans von Ayn Rand aus dem Jahr 1943, wird die Geschichte des jungen Architekten Howard Roark erzählt. Roark, zu Beginn Mitte Zwanzig, dessen autistisches Wesen seine Schöpferin als Folie für ihre pseudophilosophischen Konstrukte eines obskuren „Objektivismus“ benutzt, zeigt sich unbewegt gegenüber Urteilen seiner selbst und seiner Arbeit. Allein der eigenen Auffassung von Wahrheit verpflichtet , schreitet der Mann durch Intrigen und Widerstände hindurch, als wären sie alle um ihn herum reinste Luft. Hustenreiz? Fehlanzeige. Genie? Möglicherweise. Das Geniale bleibt vage, muss vage bleiben, um nicht die Leistung eines derart Aufrechten als allein von der Natur bestimmt zu begründen.
Roark, sehr passiv (leidend?) gegen ein Establishment, dem anzugehören entweder die Geburt oder die schäbige Intrige geholfen hat; Roark (passiv) für Unabhängigkeit und eine Integrität, die sich vor allem aus dem eigenen Anspruch formt, Herr aller Entscheidungen zu bleiben. Kompromisse, diskursiver Austausch? Nichts davon, alle wesentlichen Gespräche fussen auf einem Ja oder Nein.
Dass Ayn Rand, eine wenigstens umstrittene Autorin, bei der Romanfigur Howard Roark an Frank Lloyd Wright gedacht haben mag, deutet sie in den Bildern an, die der Architekt für seine Architekturentwürfe wählt. Ob sie ihn auch als Menschen mit dem wirklichen Architekten gleichsetzt, ist offen. Auch deswegen, weil das Romanpersonal auffallend und durchgehend plakativ bleibt und wie im Labor geschaffene Konstrukte darstellt, Folien für Vorstellungen von Charakteren. Jede Figur steht für Staffagematerial, aus dem Rand ihr Gesellschaftskonstrukt bastelt.
Am dem Abend, an dem Gudrun Landgrebe aus dem Roman vorlas, hielt der Schweizer Architekt Andreas Bründler die „Rede zur Architektur“. Unter dem Titel „Stein des Anstosses“ sprach der Schweizer über die Arbeiten des Basler Büros Buchner Bründler Architekten und resümierte das Meiste in der Aufforderung, Architektur wieder als eine sehr individuelle, abgewogene Reaktion auf den Ort zu sehen. Eine Architektur, die auch das soziale Miteinander als eine Art von Übereinkunft betrachtet, in der wir die Dinge, auch die Architektur, immer wieder aushandeln müssen. Das ist Roarks und damit Ayn Rands Sache nicht.
Warum aber den Roman lesen? Weil er trotz all der genannten Schwächen und seiner Fokussierung auf eine wie auch immer geartete Anti-Elite ein Erzählfluss ist, in dem man schwimmt ohne Widerstände, in dem Menschenschablonen auf- und abtauchen, die in ihrer Holzschnittartigkeit ein Menschenbild produzieren, das wieder gefragt zu sein scheint. Man sieht die Grabenkämpfe in den USA anders, wo die wackeligen und durchaus gefährlichen Thesen Rands heute immer noch einflussreich sind, erkennt das Schwarz-Weiss im Denken besser, die Radikalität in der Ablehnung konsensualen Miteinanders. Die Sprache Rands, die weder einem Humor noch einem Wenn und Aber Raum einräumt, die, auf Härte und Geradeaus getrimmt, elitäre Wahrheit für sich reklamiert, ist für ein Philologenseminar interessant. Sie erleichtert uns die Lesearbeit, weil man sich nicht festhaken möchte, sich nicht die Augen (und auch nicht das Hirn) reibt, sondern vorwärts getrieben ist wie jemand, hinter dem der Teufel her ist. Das ist für den 1 000-Seiten-Sprint hilfreich in einem als Klassiker gehandelten Werk solcherart schräger, überholt geglaubter Populärliteratur. Be. K.
37 €, ISBN 978-3-940431-66-0