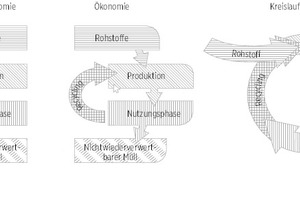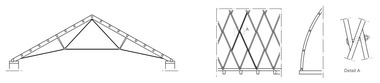Herausforderung als Chance – Nachhaltigkeit
in der Tragwerksplanung
Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sind ein großes Thema für die Planung von Hochbauprojekten. Dass auch die Tragwerksplanung in diesem Prozess eine große Rolle spielt und wie wichtig dies für den Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen ist, beschreibt Patrick Teuffel im seinem Beitrag.
Das Pariser Klimaschutzabkommen [1] und auch die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen [2] legten 2015 zum ersten Mal konkrete und anspruchsvolle Pläne vor, um gegen die globale Klimaerwärmung vorzugehen. So soll beispielsweise der Energiebedarf bis in das Jahr 2030 deutlich reduziert, Ressourcen besser genutzt und Müll vermieden werden. Hierbei spielt die Bauindustrie eine große Rolle, da diese aktuell für ca. 40 % der durch Energie erzeugten CO2-Emissionen verantwortlich ist (Abb. 01).
Graue Energie und Materialressourcen
Ein wesentlicher Einflussfaktor, der bisher in viel zu geringem Umfang betrachtet wurde, ist die graue Energie, das heisst, die Energie, die zur Herstellung, zum Transport und der Entsorgung der Baumaterialien benötigt wird. Während in den vergangenen zwei Jahrzehnten große Fortschritte erzielt wurden, wenn es darum ging, den Ener-giebedarf im Gebäudebetrieb zu reduzieren, wurde der Einfluss der grauen Energie bisher nur am Rande betrachtet (Abb. 02). Die Bedeutung der grauen Energie im Hochbau wird beispielsweise anhand von Lebenszyklusanalysen von verschiedenen Typen von Wohngebäuden untersucht und dargestellt [5]. Hierbei wird neben der Energie, die während der Nutzung (das heisst Instandhaltung, Ersatz, Energiebedarf in der Betriebsphase) benötigt wird, auch die Herstellung (das heisst Rohstoffaufbereitung, Transport und Herstellung des Baumaterials) sowie die Entsorgung (Abfallbewirtschaftung und -beseitigung) berücksich-tigt. Die Studie zeigt jedoch auch, dass es hier keine einfache Lösung und kein „Richtig“ oder „Falsch“ gibt, da die einzusetzende graue Energie (z. B. Massivbau vs. Leichtbau) unter Umständen widersprüchliche Optima gegenüber der zukünftig benötigten Energie während des Betriebs hat. Daher muss dies jeweils im Einzelfall von allen an der Planung Beteiligten untersucht und optimiert werden.
Aber nicht nur die Energie, die für die Herstellung der Materialien und Bauwerke benötigt wird, steht aktuell im Fokus, sondern auch die Verfügbarkeit der Materialressourcen selbst spielt eine große Rolle. So wird seit einigen Jahren vermehrt über die Knappheit von Sand berichtet, da sich der Bedarf in den letzten 20 Jahren auf ca. 40 – 50 Mrd. Tonnen pro Jahr verdreifacht hat [6]. Die scheinbar endlosen Sandvorräte in den Wüsten der Welt lassen sich aufgrund ihrer Beschaffenheit zum Großteil gar nicht für den Einsatz in Beton bzw. als Baumaterial verwenden.
Somit wird deutlich, dass sich in Zukunft auch die Tragwerksplanung stärker mit einem verantwortungsvollen Umgang mit den begrenzt vorhandenen Ressourcen beschäftigen sollte. Im Folgenden werden verschiedene Ansätze beschrieben, wie das erreicht werden kann.
RE-DUCE: Leichtbau und Optimierung
Leicht zu bauen ist eine offensichtliche Möglichkeit, um Material einzusparen und hat auch eine lange Tradition, angefangen bei Pionieren wie Buckminster Fuller („How much does your building weigh“) oder Frei Otto. In diesem Bereich gibt es einige weltbekannte Vorzeigeprojekte, wie das Olympiastadion in München oder spektakuläre Bauten auf der Expo in Montreal von 1967. Auch in der Forschung gibt es in diesem Bereich vielfältige und vielversprechende Arbeiten. Der Ansatz, die Tragstruktur zu optimieren und Material zu sparen, spielt aber bei „normalen“ Bauwerken, wie im Wohnungsbau oder bei Gewerbeimmobilien, bisher kaum eine Rolle. Das ist unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit natürlich nicht erstrebenswert, da die verbauten Massen hier ein Vielfaches im Vergleich zu einigen wenigen Stadion- oder Vorzeigeprojekten betragen.
Verschiedene Methoden und Ansätze zur Optimierung von Strukturen liegen eigentlich seit Jahrzehnten theoretisch vor und wären durch leistungsfähige Rechner, die heute im Alltag zur Verfügung stehen, in vielen Bereichen auch praktisch einsetzbar. Während solche Methoden in anderen Branchen, wie dem Maschinen- oder Fahrzeugbau, intensiv eingesetzt werden, ist die Bereitschaft hierzu im Bauwesen bisher noch eher zurückhaltend.
Dies soll anhand eines konkreten Beispiels näher erläutert werden: Bei Hochbauten werden in der Regel mindestens 60 % des Materials für die Deckensysteme verwendet, während der Rest sich auf Stützen, Wände und die Fundamente verteilt. Es wäre daher aus wirtschaftlicher Sicht, aber auch aus der Perspektive der Nachhaltigkeit sinnvoll und vielversprechend, diese Bauteile stärker zu optimieren, um den Materialverbrauch und damit Kosten wie auch C02-Emissionen zu reduzieren. Verschiedene Studien [4] zeigen jedoch, dass in der Praxis die Ausnutzung der Bauteile selten höher als 80 % liegt, obwohl eine Ausnutzung von bis zu 100 % absolut vertretbar wäre, da ja gewisse Unwägbarkeiten, sowohl auf der Material- als auch auf der Belastungsseite durch die in der Norm vorgegebenen Sicherheitsfaktoren abgedeckt sind. Hier wäre sicher ein Aufklärungsbedarf in Richtung Architekten und Bauherren zu sehen, da eine planmäßige Ausnutzung von 100 % (oder gegebenfalls auch etwas mehr) in der Regel nicht zu einem Schaden führen würde, stattdessen eher das Zusammentreffen von verschiedenen konzeptionellen Problemen zu großen Schäden führen kann [7].
Die Frage ist, ob und wie solche Optimierungsstudien in den normalen Planungsprozess integriert werden können: Einerseits wäre es in den meisten Fällen sicher erreichbar, dass 10 – 20 % Materialeinsparung erzielt werden können. Dies würde aber zu einer weiteren Planungsphase führen, die zum einen nicht durch die HOAI abgedeckt ist und weiterhin Zeit benötigt, die in der Regel auch wieder Geld kosten würde.
Neben der Optimierung der Struktur sind realistische Belastungsannahmen ein wesentlicher Einflussparameter bei der Entwicklung von ressourcensparenden Tragwerken. Zwar sind die anzusetzenden Lasten in Normen geregelt. Studien [4, 8] und praktische Erfahrungen zeigen jedoch, dass im Hochbau in den meisten Fällen die tatsächlich auftretenden (Verkehrs-)Lasten nur ca. 20 – 30 % derjenigen betragen, die aufgrund der Normung anzusetzen sind. Gleiches gilt auch bei der Annahme von Ausbaulasten durch die technische Gebäudeausrüstung.
RE-USE: Wiederverwendung und Kreislaufwirtschaft
„Die Europäische Kommission hat 2015 einen Aktionsplan angenommen, der dazu beitragen soll, den Übergang Europas zu einer Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen, die globale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern und neue Arbeitsplätze zu schaffen.“ [9]
Ein Vorreiter innerhalb der Europäischen Union ist sicherlich die niederländische Regierung, die im Jahr 2016 ihr Programm „Nederland Circulair in 2050“ präsentiert, in dem das Ziel formuliert wird, dass die Wirtschaft bis in das Jahr 2050 in eine vollständige Kreislaufwirtschaft transformiert werden soll. In Deutschland wird dieser Ansatz seit 2018 durch Boni im Bewertungssystem der DGNB gefördert [10].
Dies stellt auch die Bauwirtschaft vor eine große Herausforderung. Grundsätzlich kann das Thema der Wiederverwendung bzw. der Kreislaufwirtschaft auf drei unterschiedlichen Ebenen betrachtet werden: 1. Material, 2. Bauteil, 3. Bauwerk.
Die Möglichkeit des Materialrecyclings ist bei den unterschiedlichen Werkstoffen sehr verschieden: Während die Recyclingrate beim Baustahl bei 99 % liegt [12], ist die Wiederverwendung von Beton deutlich schwieriger zu realisieren, auch wenn hier in den letzten Jahren intensiv erfolgsversprechende Verfahren erforscht wurden [13].
Ebenso gibt es aktuell einige interessante Entwicklungen, bei denen einzelne Komponenten wiederverwendet werden: Im Rahmen des von der EU geförderten Forschungsprojekts BAMB (Buildings as material banks) wurde dies näher untersucht [14]. Auch hier werden Themen wie Kreislaufwirtschaft im Bauwesen, nachverfolgbare Materialströme, Rückbaukonzepte oder neue Geschäftsmodelle entwickelt. Ein sehr guter Überblick zur Recyclierbarkeit wird beispielsweise in [15] gegeben.
Die effektivste Möglichkeit, effizient mit Ressourcen umzugehen, besteht darin, bestehende Gebäude nicht abzureißen, sondern zu untersuchen, ob und wie diese umgenutzt werden können. In diesem Zusammenhang sollen auch noch einmal die drei Säulen der Nachhaltigkeit – Ökologie, Ökonomie sowie Soziales – betont werden. Hierzu wurde an der Technischen Universität Eindhoven eine Methode entwickelt, mit der das Umnutzungspotential systematisch untersucht und bewertet werden kann [16]. Dabei werden die einzelnen Bestandteile wie Tragwerk, Gebäudehülle oder die Haustechnik hinsichtlich verschiedener Indikatoren, wie Demontierbarkeit, Anpassungsfähigkeit oder weiterer Nutzbarkeit, untersucht und ihr Einfluss auf eine mögliche Umnutzung des Bauwerks bewertet. Die Auswertung dieser Bewertung gibt neben einem Einblick in das Umnutzungspotential des Bauwerks auch eine Vorstellung zur „Überlebenswahrscheinlichkeit“ des Gebäudes für die kommenden Jahrzehnte.
Ein prominentes Beispiel für die Umnutzung einer vorhandenen Struktur ist das Projekt Prora, Block 1 auf der Insel Rügen. Die ehemalige KDF-Anlage Prora aus dem Dritten Reich wurde umfangreich saniert. Bei der Sanierung wurden auch grundlegende konstruktive Eingriffe in die denkmalgeschützte Bausubstanz notwendig, die für die Tragwerksplanung große Herausforderungen darstellten. Um die Gesamtstruktur dauerhaft weiternutzen zu können, mussten beispielsweise teilweise bestehende Decken und Unterzüge in den Treppenhaustrakten entfernt und durch slim-floor-Decken ersetzt werden, um die aktuellen Anforderungen an die lichte Mindestgeschosshöhe zu erreichen.
Weiterhin wurden umfangreiche Bestandsuntersuchungen durchgeführt, um für die Planung zuverlässige Grundlagen, wie Materialgüte oder Karbonatisierungstiefe, zu bekommen. Die visuellen Prüfungen waren ebenso wie Laboruntersuchungen für die Ermittlung der Tragfähigkeit und zur Beurteilung des Sanierungsbedarfs notwendig. In [17] sind weitere technische Aspekte, wie der Neubau der Liegehäuser oder Maßnahmen im Rahmen der Sonderabdichtungen, beschrieben.
RE-NEW: Nachwachsende Rohstoffe
Eine weitere Möglichkeit, nachhaltige Tragwerke zu planen, ist die Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen, wobei natürlich Holz eine schon lange bekannte Alternative ist und aktuell auch ein Revival erlebt. Allerdings sind auch hier die Möglichkeiten nicht unbegrenzt, da der hohe Baustoffbedarf nicht allein durch Holz abgedeckt werden kann. Neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten hier beispielsweise faserverstärkte Verbundwerkstoffe, die aus Naturfasern und bio-basierten Harzen bestehen. So wurde auf dem Campus der Technischen Universität in Eindhoven 2016 eine Fußgängerbrücke mit 14 m Spannweite aus einem Hanf-Flachs-Verbundwerkstoff geplant und realisiert [18]. Im Rahmen dieses Projekts wurden verschiedene Harze sowie biobasierte Faser(-kombinationen) hinsichtlich ihrer mechanischen Eigenschaften untersucht und getestet, ob und wie diese für eine im öffentlichen Raum stehende Brücke, die alle normalen Genehmigungsprozesse durchlaufen muss, verwendet werden können. In einem aktuellen Forschungsprojekt wird mittels integrierter Dehnungsmess-Sensoren das Langzeitverhalten des Baustoffs, also das Kriechen, aber auch Einflüsse durch Feuchtigkeit oder UV-Einstrahlung überwacht und beurteilt [18]. Weitere interessante, natürliche Baustoffe wie Myzelium und einige andere werden in [19] umfangreich beschrieben.
Ausblick
Ziel der deutschen Regierung ist es, bezogen auf das Referenzjahr 1990 bis in das Jahr 2050 die Treibhausgase um bis zu 80 – 95 % zu reduzieren. In einer vom BDI beauftragten Studie [20] wird das Ziel von 80 % als technisch machbar und volkswirtschaftlich verkraftbar angesehen, während eine Reduktion von 95 % an die Grenze der technischen Machbarkeit sowie gesellschaftlichen Akzeptanz wäre. Aktuell ist noch nicht klar, wann und in welchem Umfang hierzu auch gesetzliche Vorgaben, vergleichbar zur Energieeinsparverordnung (EnEV) kommen werden. Unklar ist auch, welche Hebel dafür eingesetzt werden, beispielsweise eine CO2-Steuer oder der Emissionshandel. Aber in jedem Fall sollten sowohl Planer als auch Bauherrn sich rechtzeitig mit dem Thema beschäftigen und darauf vorbereitet sein. Die oben beschriebenen Ansätze – RE-DUCE, RE-USE und RE-NEW – bieten aus Sicht des Autors für alle am Bau beteiligten Planer und auch Bauherren interessante Möglichkeiten, hier einen nachhaltigen Beitrag zu einer positiven gesellschaftlichen Entwicklung zu leisten. Um hier erfolgreich zu sein, ist nicht nur eine frühzeitige und enge Zusammenarbeit der verschiedenen Planungsdisziplinen untereinander und mit den Bauherrn nötig, sondern auch eine aktive Einmischung in Politik und normative Verfahren erforderlich. Die damit verbundenen Herausforderungen sollten für die Bauenden nicht als Bedrohung, sondern als Chance gesehen werden. Es wird auch interessant sein, wie diese Entwicklung Einfluss auf den Entwurfs- bzw. Entwicklungsprozess und die daraus resultierende gebaute Umwelt haben wird.
Literatur
[1] „Paris Agreement” in: United Nations Treaty Collection, 2016
[2] United Nations: Sustainable development goals, https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ (30.08.2019)
[3] UN Environment and International Energy Agency: Towards a zero-emission, efficient, and resilient buildings and construction sector: Global Status Report 2017, 2017
[4] John Orr, et. al.: Minimising Energy in Construction - Survey of Structural Engineering Practice, 2018
[5] Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, Lebenszyklusanalyse von Wohngebäuden, 2017
[6] UN Env:ironment: Sand and Sustainability: Finding new solutions for environmental governance of global sand resources, 2019
[7] Levy, M.; Salvadori, M.: Why Buildings Fall Down, 1994
[8] Bachmann, H.; Rackwitz, R.; Schueller, H. I.: „Tragwerkszuverlässigkeit - Einwirkungen“, in: Der Ingenieurbau, Band 8, 1997
[9] Europäische Kommission: Auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft, https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_de, (30.08.2019)
[10] DGNB: Circular Economy, 2019.
[11] Government of the Netherlands: A Circular Economy in the Netherlands by 2050, 2016
[12] VDI Zentrum Ressourceneffizienz: Ressourceneffizienz der Tragwerke, 2013.
[13] Fraunhofer Institut: BauCycle, 2019
[14] Buildings as material banks, https://www.bamb2020.eu/ (30.08.2019)
[15] Hillegrandt, A;Riegler-Floors, P.; Rosen, A.; Seggewies, J.: Atlas Recycling: Gebäude als Materialressource, 2018
[16] Blok, R.; Teuffel, P.: “Demolition versus Transformation, “mortality of building structures” depending on their technical building properties”, in: SBE19 Brussels BAMB-CIRCPATH conference proceedings, 2019
[17] Teuffel, P.; Hillers, B.: „Weltbekanntes Baudenkmal – Neues Prora auf Rügen“, in: Ingenieurbaukunst 2018, Hrsg: Bundesingenieurkammer, Ernst & Sohn, 2018
[18] Blok, R., Smits, J., Gkaidatzis, R.; Teuffel, P.: „Bio-based composite footbridge: design, production and in situ monitoring“, in: Structural Engineering International, 2019
[19] Hebel, D.E.;Heisel, F.:Cultivated Building Materials, 2017
[20] Boston Consulting Group, Klimapfade für Deutschland, 2018

![01 Verursacher der globalen CO2-Emissionen je Industriesektor [3]](https://www.dbz.de/imgs/1/4/9/4/7/7/7/tok_e7da1f69b2e07d01ee97ba9c07b62ca4/w298_h200_x149_y167_3c9d3c349894afaa.jpg)
![02 Steigender relativer Anteil der grauen Energie [4]](https://www.dbz.de/imgs/1/4/9/4/7/7/7/tok_51237fe58292d54aef1ab02a9de9f82e/w300_h186_x282_y93_4866a7c9f895bbfd.jpg)