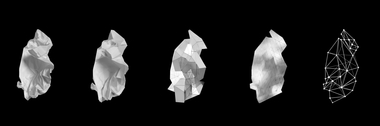Wir müssen reden. Über den wichtigsten Beruf der Welt
Das Berufsbild des Architekten greift angesichts der gesellschaftlichen Herausforderungen viel zu kurz. Architekten müssen ihren Beruf neu erfinden, meint Gerhard Matzig.
Seit mehr als einem Vierteljahrhundert schreibe ich als Kulturjournalist bevorzugt für die Süddeutsche Zeitung und ebenso vornehmlich über Städtebau, Architektur und Wohnthemen. In dieser Zeit hätte ich mich als Architekturkritiker von Rang etablieren können. Ja, eigentlich müssen. Die Bedingungen dafür waren ideal.
Dazu zählt die immer noch gewaltige Architektendichte in Deutschland, wo es allein in Bayern mehr Planer geben soll als in ganz Frankreich. Dazu zählt aber auch ein enorm entwickeltes, zum kleineren Teil wutbürgerlich motiviertes, zum größeren Teil kritisch-konstruktives, jedenfalls öffentlich bekundetes Interesse an echten oder vermeintlichen Bauskandalen, die von Stuttgart 21 über des Bischofs Badewanne in Limburg bis zum Großflughafen Berlin reichen, dessen Vollendung man absurderweise noch vor der Kulturjournalistenrente erwartet.
Zum öffentlichen Interesse zählt aber auch so etwas wie die Rekonstruktionsdebatte rund um die Frankfurter Innenstadt. Die tendenziell närrische Frage, ob Leute, die Fachwerk mögen, quasi politästhetisch auch dem Nationalsozialismus nahestehen müssen, ist diesbezüglich noch nicht abschließend geklärt. Wie das auf dem Terrain des Närrischen ja oft der Fall ist.
Jedenfalls: Es gibt sehr viele Architekten in Deutschland, nicht ganz so viel Baukultur und insgesamt ein umfassendes, nicht immer auch baukulturell grundiertes, also wissendes Interesse am Tun der Planer und Gestalter. Nimmt man noch die kein bisschen weniger überbordenden Themen zur Stadtverdichtung wie zum Landsterben hinzu, obendrein das riesenhafte Infrastrukturproblem, die Wohnungskrise und den Klimawandel, der zwar per amerikanisch-präsidialem Tweet verboten wurde, sich aber illegalerweise dennoch mit Stadt, Wohnen und Verkehr zu einem etwas größeren Komplex entwickelt hat, so kommt man kaum umhin, festzuhalten: Als Architektinnen und Architekten, Landschaftsplaner, Baubeamte, Innenarchitekten und alle anderen Fachleute, die an der räumlichen, dabei immer komplexer werdenden Organisation der immer schwieriger zu fassenden Gesellschaft beteiligt sind, befinden sich die Experten derzeit im Epizentrum alles entscheidender, grundlegender Fragen. Der aus dem 18. Jahrhundert stammenden, relativ selbstbewussten Behauptung des französischen Klassizisten Claude-Nicolas Ledoux, wonach Architekten die „Rivalen des Schöpfers“ beziehungsweise auch die „Titanen der Erde“ seien, würde man schon deshalb nur zu gern folgen.
Architekten und Stadtplaner, Leute, die über Verkehrsströme, neue Wohnformen, ein neues Bodenrecht oder auch „nur“ über die Frage nachdenken, ob der Nachverdichtung in den Städten nicht wenigstens eine Nachbegrünung korrespondierend gegenüberstehen müsste, gehören aber auch so zur Profession der Stunde. Und man selbst wäre als Architekturkritiker in medial ebenso immer komplexer werdenden Zeiten eigentlich der ideale Herold dieser Heroik. Wäre man als Architekturkritiker in Wahrheit nicht eher so etwas wie ein Paartherapeut. Denn das, was die Architektenschaft kann und jenes, was die Welt nachfragt, das steht sich paradoxerweise genau jetzt so fremd gegenüber wie kaum je zuvor. Sagen wir es so: Architekten leben auf dem Mars – und der Rest auf der Venus. Oder umgekehrt. Wir müssen folglich reden. Dringend.
Seit mehr als einhundert Jahren haben die Architekten in aller Welt um gesellschaftliche Anerkennung als holistische, Technik und Kunst im vitruvianischen Sinn verbindende Baukünstler gerungen. Das zeigt sich sogar in der selbstbewussten Behauptung von Frank Lloyd Wright, wonach er der bedeutendste Architekt der Welt sei. Das ist auch herauszulesen aus den Manifesten, die sich Walter Gropius als Direktor am Bauhaus ausdachte, das vor ziemlich genau 100 Jahren gegründet wurde. Und es ist letztlich auch die Essenz der Corbusier-Formel vom Spiel der Formen unter dem Licht. Das wahrhaft oder auch nur vermeintlich Titanische ihres Tuns hat aber im Jahrhundert der Künstler-Architekten lange überdeckt, dass das Bauen einst aus dem Handwerk hervorgegangen ist. So kam es irgendwann zum Schisma zwischen Technik und Kunst, zwischen Fundament und Überschuss.
Es gab unter den Architektinnen und Architekten gottbegnadete Schöpfer-Rivalen, die eigentlich nicht Pläne realisierten, sondern Kunst als solche erschufen – und es gab den Rest. Nämlich jene Leute, die dafür zuständig sind, dass es nicht durch das Dach regnet und der Bau zum vereinbarten Zeitpunkt fertig ist. Idealerweise im Rahmen der zuvor berechneten Kosten. „Stararchitekten“ wurden die einen – und die anderen wurden zu Dienstleistern am Bau. Die einen verehrt man im günstigsten Fall als exaltierte Künstler (auch wenn man ihnen in technisch-rationaler Hinsicht nicht viel Zutrauen entgegenbringt). Die anderen respektiert man als Experten (auch wenn man ihnen in baukultureller und ästhetischer Hinsicht eher misstraut). Diese Dichotomie ist indessen einem Beruf, der zugleich technisch wie kulturell zu begreifen wäre, kaum angemessen. Sie ist obendrein veraltet – als Denken aus dem 20. Jahrhundert der klassischen Moderne.
Tatsächlich müssen Architekten gerade jetzt, am Beginn des dritten Jahrtausends, beides sein: Rationalisten und Utopisten. Architektur wird in den Medien oft nur als Oberflächenphänomen wahrgenommen, als das Design von Bauten. Das Bauen wird insofern auf die Herstellung einer Ästhetik reduziert. Logischerweise hat das auch zu dem Unsinn geführt, dass einige Architekten eine Art Logo-Architektur herausgebildet haben, ein signifikantes Markenbewusstsein, das an ganz unterschiedlichen Orten und anlässlich völlig divergenter Bauaufgaben doch immer wieder das gleiche Schnittmuster erkennen lassen. Als sei das dahinterstehende Büro keine Manufaktur, sondern eine global herumgereichte Markenbotschaft.
Im Zeitalter, wo Überbevölkerung, Klimawandel, Wohnen und Verkehr, dazu Verstädterung und Landflucht zunehmend zu Problemen führen, die mit einem von Inhalten losgelösten Formwillen allein längst nicht mehr beherrschbar sind, ist aber auch die Manufaktur („das gute Bauen“) überfordert. Egomanische Stararchitekten, vorbildliche Manufakturisten und am Umsatz orientierte Dienstleister und Befehlsempfänger: Alle diese Klischees, die naturgemäß selten in Reinform anzutreffen sind, greifen angesichts der stadtplanerischen und architektonischen Herausforderungen unserer Epoche viel zu kurz. So vermessen es auch klingt: Architektinnen und Architekten, Planer und Planerinnen müssen vor diesem Hintergrund ihren Beruf neu erfinden.
Tatsächlich müssen sie titanischer denken, nicht als Kunstbauende, nicht als Baukünstler, sondern als Problemlöser. Als die Experten, deren Stunde schlägt wie niemals zuvor. Wer heute Architekt ist, ist mehr als das. Aber gerade deshalb wäre der Beruf wieder zu versöhnen mit einer Gesellschaft, die sich angewöhnt hat, Architekten als Heilsbringer des Schönen zu verehren oder als Verursacher beinahe aller Boshaftigkeiten zu verteufeln, als da wären Verlust der Heimat, identitätslose Städte, Pfusch am Bau ... Architekten sind weder reine Künstler noch reine Narren. Ihr Tun ist so bedeutsam wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Dann sollte sich allerdings die gesellschaftliche Rezeption vom Wirken der Architektenschaft mindestens auf Augenhöhe befinden.